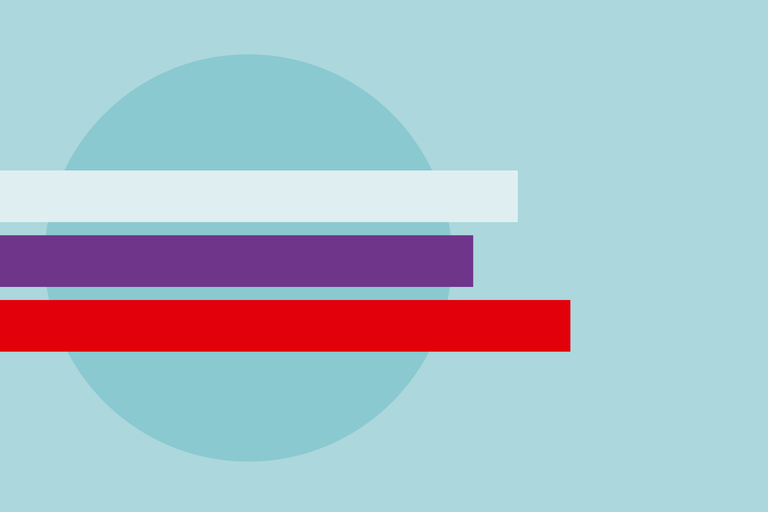Diskriminierung: Forschen als Politik
Frauen werden oft ungerecht schlecht bezahlt, sagt die Wissenschaftlerin Karin Tondorf. Doch es ist unredlich, die statistische Lohnlücke mit dem Grad der Lohndiskriminierung gleichzusetzen. Man muss vielmehr Betriebe und Tarifwerke einzeln durchforsten. Von Stefan Scheytt
Es war neulich bei einer Podiumsdiskussion, als der Vertreter eines Arbeitgeberverbandes – ein Mann – mit dem Unterton der Empörung seine Zuhörer fragte, er wolle jetzt wirklich einmal wissen, wo es denn bitte schön in Deutschland bei der tariflichen Bezahlung noch eine Diskriminierung von Frauen gäbe. Das sei doch längst überwunden und sowieso verboten. Auf dem Podium saß auch Karin Tondorf, die sich seit mehr als 20 Jahren wissenschaftlich mit dem Thema der ungleichen Bezahlung von Frauen und Männern beschäftigt, die darüber für Bundesministerien und für die Hans-Böckler-Stiftung gearbeitet hat, vor Bundestagsfraktionen und wissenschaftlichen Gremien referierte. Innerlich mag sie die Augen verdreht haben. Doch ihrer Replik am Mikrofon war davon nichts anzumerken. Ruhig und sachlich wie immer trug sie ihre Argumente vor. „Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass alles in Ordnung wäre, sobald Tarifverträge nicht mehr zwischen Männern und Frauen unterscheiden“, sagt sie. Wer so denke, mache es sich zu einfach und habe das Problem der mittelbaren Diskriminierung nicht verstanden. Ihre Forschung setzt da an, wo die offensichtliche Diskriminierung aufhört. Sie fragt nicht nur danach, ob gleiche Arbeit auch gleich bezahlt wird, sondern welche unterschiedlichen Tätigkeiten gleichwertig sind und deswegen auch gleich bezahlt werden müssen.
Tondorf hat selbst eine ungewöhnliche Berufsbiografie. Ende der 60er Jahre machte sie eine Lehre als Kauffrau bei Siemens in Essen. Dann arbeitete sie als Verwaltungsangestellte im Bundestag, danach acht Jahre als Gewerkschaftssekretärin. Mit 30 holte sie das Abitur nach, studierte mit einem Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung Soziologie, lehrte fünf Jahre an der FU in Berlin und forschte zwei Jahre am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung. Seit 1996 ist Tondorf, die über die Modernisierung der industriellen Entlohnung promovierte, freiberuflich als Wissenschaftlerin und Beraterin tätig. Meist ging es dabei um den gerechten Lohn für Frauen, um moderne, nichtdiskriminierende Entlohnungssysteme.
WAS IST DER RICHTIGE MASSSTAB?
Sie selbst sei zwar nie von Lohndiskriminierung betroffen gewesen, sagt Karin Tondorf, doch die Ungerechtigkeit, die Vorurteile und Stereotypen beim Thema Frauenentlohnung, die ihr schon während ihrer Zeit bei der Gewerkschaft HBV immer wieder begegneten, forderten sie heraus. Warum, fragt sie, wird zum Beispiel die Arbeit eines Leiters der Betriebswerkstatt bei einem Mittelständler höher eingruppiert als die Leiterin der Kantine? Ist die Arbeit einer gelernten Verkäuferin im Einzelhandel 600 Euro im Monat weniger wert als die eines Schlossers? Warum wird die Lehrtätigkeit an Grundschulen, die in der Mehrheit von Frauen ausgeübt wird, schlechter bezahlt als die Lehrtätigkeit an Gymnasien oder beruflichen Schulen? Und warum bekommt eine Erzieherin weniger als ein Bautechniker?
In der öffentlichen Debatte ist es vor allem eine simple Prozentzahl, die die Debatte um die Entgeltdiskriminierung bestimmt: die statistische Lohnlücke zwischen den Geschlechtern, auf Englisch: Gender Pay Gap. Nach einer Studie der OECD in 34 Industriestaaten ist diese Lohnlücke nirgendwo größer als bei uns: In Deutschland verdienen vollzeitbeschäftigte Frauen durchschnittlich fast 22 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen, während die Lücke im Schnitt aller OECD-Länder 16 Prozent beträgt und Länder wie Norwegen oder Belgien deutlich niedrigere Werte von 8 bis 9 Prozent erreichen. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts verdienten Frauen in Deutschland 2010 im Schnitt sogar 23 Prozent weniger als Männer. In konkreten Zahlen sieht das so aus: Während ein Mann im vergangenen Jahr einen durchschnittlichen Bruttoverdienst von 3508 Euro erzielte, kam eine Frau auf 2861 Euro.
Doch die Interpretation solch aggregierter Zahlen ist hochkomplex. Ein Teil der statistischen Lohnlücke ist sachlich gerechtfertigt, weil er reale Unterschiede in der Wertigkeit von Arbeitsplätzen abbildet. Ein weiterer Teil erklärt sich aus ungleichen Chancen, vor allem durch Kinderbetreuung und Pflegeaufgaben: Frauen wählen dann Jobs, die Teilzeitarbeit ermöglichen, unterbrechen ihre Arbeit und stellen ihre Karriere oft jahrelang zurück – mit den entsprechenden Nachteilen für Lohn und Gehalt. „Dies ist allerdings noch keine Diskriminierung“, kommentiert Tondorf. „Dagegen muss man politisch vorgehen. Überzeugende Beispiele dafür sind Frankreich oder Skandinavien.“ Wie stark Frauen bei ihrer Bezahlung diskriminiert werden, käme durch den unbereinigten Gender Pay Gap des Statistischen Bundesamts aber gar nicht zum Ausdruck, kritisiert Karin Tondorf. Entscheidend sei vielmehr die Frage, wofür – sprich für welche Arbeit – Frauen und Männer ihren Lohn erhalten. Und dafür lautet der Rechtsgrundsatz: Gleiches Entgelt für gleiche und gleichwertige Arbeit.
LOHNSYSTEME AUF DEM PRÜFSTAND
Die Antworten auf die Fragen, die die Forscherin stellt, stecken in den Systemen der Arbeitsbewertung, wie sie in Tarif- oder Betriebsvereinbarungen geregelt sind. Tondorfs Verdacht: Sie bilden die tatsächlichen Anforderungen und Belastungen vieler Tätigkeiten von Frauen nicht angemessen ab – mit den entsprechenden Konsequenzen fürs Entgelt. „Das Problem ist nicht, dass junge Frauen Frisörin werden, Erzieherin oder Grundschullehrerin“, meint Karin Tondorf, „der Kern des Problems ist, dass viele frauentypische Berufe einfach weniger Wertschätzung erfahren, obwohl sie die gleichen oder sogar höhere Anforderungen stellen.“ Etwa bei den Lehrern. Dort würde nach dem Muster entlohnt: Kleine Kinder – kleines Geld, große Kinder – großes Geld. Der fachliche Anteil des Lehrerberufs würde hier im Vergleich zum erzieherischen Anteil überbewertet. „Tätigkeiten mit Kindern, in der Pflege oder im haushalterischen Bereich sind notorisch unterbewertet und unterbezahlt, weil sie von Frauen verrichtet werden.“
Psychosoziale Kompetenzen wie Einfühlungsvermögen, Kommunikations- und Teamfähigkeit werden regelmäßig in Stellenanzeigen gefordert, aber in vielen Tarifverträgen gar nicht bewertet und dann auch nicht entsprechend entlohnt. Auch bei der Frage, welche Verantwortung eine Tätigkeit erfordert, würde zwar die Verantwortung für Geld und Sachwerte oder Führungsverantwortung regelmäßig bewertet, nicht aber die Verantwortung für Menschen. „Arbeit mit und an Menschen wird in Deutschland strukturell unterbewertet“, argumentiert Tondorf. Wenn gleichzeitig fachliche und physische Anforderungen in typischen Männerberufen berücksichtigt werden, öffnet sich die Entgeltlücke unweigerlich.
Ein wegweisendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs erstritt Ende der 80er Jahre eine Beschäftigte in der deutschen Druckindustrie; als „Fall Rummler“ ist es unter Fachleuten ein Begriff. „Damals entschied der EuGH, dass bei der Arbeitsbewertung alle wesentlichen Anforderungen an Tätigkeiten von Frauen und Männern gerecht berücksichtigt werden müssen“, erklärt Tondorf. In dem damaligen Tarifvertrag wurde zwar der Einsatz von Muskelkraft in den von Männern dominierten Tätigkeiten bewertet und bezahlt, nicht aber die feinmotorische Bewegungpräzision, wie sie bei der Arbeit von Frauen erforderlich ist.
Deswegen, argumentiert Tondorf, sei die Gleichverteilung der Entgelte auch kein Hinweis auf Lohngerechtigkeit: Im öffentlichen Dienst Ostdeutschlands etwa gebe es keine Verdienstdifferenz, doch das bedeute nicht automatisch, dass die Arbeit einer kommunalen Altenpflegerin im Vergleich zu der eines Hausmeisters gerecht bewertet werde: „Wenn sich zeigt, dass die Arbeit der Frau höherwertig ist, müsste sie auch mehr verdienen als der Mann.“ Tondorf schätzt, dass bei geschlechtsneutraler Arbeitsbewertung Frauen auch in Deutschland in einigen Fällen bis zu 20 oder 25 Prozent mehr Entgelt bekommen müssten. Denn nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und nach Artikel 157 des Vertrags zur Arbeitsweise der Europäischen Union haben Frauen Anspruch auf gleiches Entgelt nicht nur bei gleicher Arbeit, sondern auch bei gleichwertiger Arbeit, mithin auch ein Recht auf mehr Entgelt bei höherwertigen Tätigkeiten.
Um versteckte Geschlechterdiskriminierung aufzudecken, haben Tondorf und ihre Kollegin Andrea Jochmann-Döll im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung 2010 den Entgeltgleichheits-Check, kurz eg-check (www.eg-check.de), entwickelt, eine Prüfmethode, mit der unter anderem die Gleichwertigkeit von Tätigkeiten festgestellt werden kann. Ähnlich dem Entgeltrahmentarifvertrag (ERA) Baden-Württemberg werden die Tätigkeiten in einem Unternehmen oder einer Behörde analytisch anhand von Haupt- und Unterkriterien einheitlich bewertet und bepunktet, um unterschiedliche Arbeiten vergleichbar zu machen. eg-check ist als rechtliches Prüfinstrument anerkannt und unterscheidet sich dadurch von dem freiwilligen Prüfinstrument „Lohngleichheit im Betrieb – Deutschland“ (Logib-D) des Bundesfrauenministeriums für Personalabteilungen.
Nach Tondorfs Meinung ist die Bezeichnung Logib-D missverständlich, denn „sie suggeriert, dass es um die rechtlich gebotene Lohngleichheit im Betrieb geht“. Geprüft werde aber nicht, ob gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit gezahlt wird, sondern ob das Entgelt den Qualifikationen der Männer und Frauen entspricht. „Leider hält sich der Irrtum härtnäckig, dass sich das Entgelt nach der Qualifikation richten müsse“, sagt Tondorf. „Aber in Deutschland gibt es keinen Qualifikationslohn: Ein Mann, der als Hilfskraft im Lager angestellt ist, bekommt nicht mehr, wenn er ein Studium vorweisen kann.“ Eine Prüfung auf Entgeltgleichheit mit diesem Instrument, warnt die Wissenschaftlerin, garantiere den Arbeitgebern nicht, im Falle von Klagen wegen Diskriminierung auf der sicheren Seite zu stehen.
EIN WEITERES GESETZ SOLL HELFEN
Das viel diskutierte AGG wird nach Karin Tondorfs Überzeugung noch nicht für eine faire Bezahlung der Geschlechter sorgen. Das Gesetz verbietet zwar Diskriminierung beim Entgelt, doch es gibt keinen verbindlichen Rahmen, der Arbeitgeber und Tarifparteien verpflichtet, ihre Entlohnung zu prüfen – und, wenn sich Diskriminierung findet, diese auch zu beseitigen. „Auf dem Weg der Freiwilligkeit wird sich nichts bewegen, wir brauchen ein zusätzliches Verfahrensgesetz, das die betrieblichen und tariflichen Akteure in die Pflicht nimmt“, meint Karin Tondorf. Noch in diesem Sommer soll ein entsprechender Entwurf von der SPD eingebracht werden, auch die Grünen und die Linkspartei sind auf diesem Weg.
Im Bewusstsein vieler Gewerkschafter habe sich in den vergangenen Jahren viel getan, auch viele Gleichstellungsbeauftragte in den Kommunen und einzelne Arbeitgeber seien sensibilisiert, bilanziert Karin Tondorf ihre Erfahrungen. Doch im Vergleich mit Skandinavien oder den USA, wo das Bewusstsein für Entgeltdiskriminierung wesentlich ausgeprägter sei als hier, sei Deutschland noch immer „politisch rückständig“. In der konkreten Entlohnungspraxis der Betriebe gebe es noch viel zu wenig Erfolge. „Wenn es in dieser Sache in Deutschland in nächster Zeit nicht vorangeht, kann ich mir vorstellen, dass auch in der EU die Unzufriedenheit wachsen wird“, meint Tondorf. Das heißt wohl: Irgendwann könnte EU-Kommissarin Viviane Reding versucht sein, unwilligen Mitgliedstaaten durch eine neue Richtlinie auf die Sprünge zu helfen.
Text: Stefan Scheytt, Journalist in Rottenburg am Neckar / Foto: Stephan Pramme