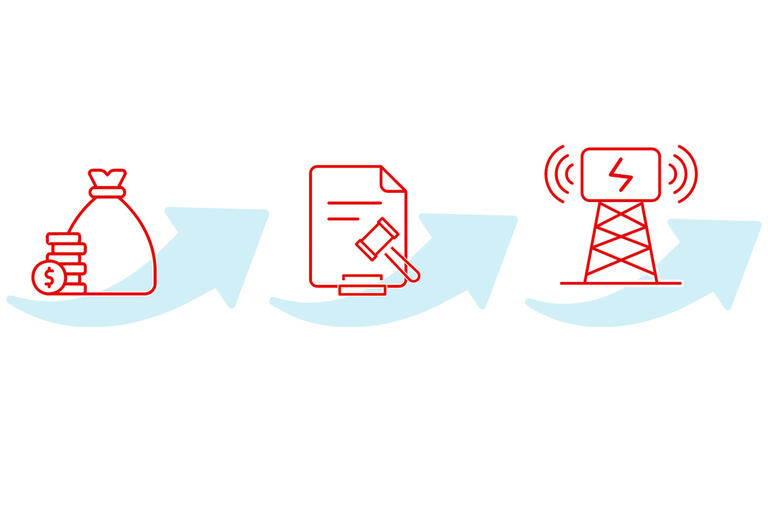: 'Der Wind hat sich gedreht'
FINANZSYSTEM Die Kapitalmarkt-Experten Reinhard H. Schmidt und Gerald Spindler über die Rückkehr der Deutschland AG, Rettungsschirme und das gestiegene Selbstbewusstsein Europas.
Das Gespräch führten Margarete Hasel und Kay Meiners, Redakteure des Magazins Mitbestimmung.
Herr Schmidt, Herr Spindler, Ökonomen und Juristen verstehen sich oft nicht allzu gut. Ökonomen stehen den gesetzlichen Eingriffen tendenziell skeptisch gegenüber, die gerade das Geschäft des anderen sind. Wie gut verstehen Sie sich?
SCHMIDT: Für uns beide kann ich Entwarnung geben. Wir arbeiten seit Jahren gut zusammen. Oft war ich sogar derjenige, der stärker vor der Liberalisierung gewarnt hat. Wir bemühen uns, die Sprache des anderen zu erlernen. Die Ökonomen beanspruchen dabei meist globale Gültigkeit, während die Juristen sich mit nationalen Rechtssystemen herumschlagen müssen.
SPINDLER: Lassen Sie mich etwas boshaft sein: Die Ökonomen dürfen sich im Sandkasten etwas ausdenken, während die Juristen oft auch Praktiker sind - zum Beispiel als Richter. Wir müssen Lösungen finden, wenn Leute nicht miteinander klarkommen. Mich interessiert, wie man mit besseren Gesetzen und mit einem besseren Vollzug Exzesse am Finanzmarkt verhindern und Schaden abwenden kann.
Das heißt, Sie sind - anders als Herr Schmidt meinte - doch der härtere Regulierer?
SPINDLER: Man muss zwischen verschiedenen Rechtsdisziplinen unterscheiden. Im Gesellschaftsrecht verstehen wir Regulierung nicht als lenkenden Eingriff. Das Gesetz soll ermöglichen, dass die Beteiligten zusammenkommen, etwa um ein Unternehmen zu gründen. Wir stellen einen Werkzeugkasten zur Verfügung. Die Marktteilnehmer verwenden ihn in einer Weise, die ihnen rational erscheint. Wenn aber der Markt teilweise versagt, wie jetzt in der Krise, dann muss man eingreifen.
Wie ist es derzeit um den Markt für die Unternehmensfinanzierung bestellt?
SCHMIDT: Die Verluste an den Wertpapiermärkten sind gigantisch. Viele Leute, die früher reich waren, sind jetzt arm oder doch ärmer. Die Summen, die jetzt für Rettungsschirme und Hilfspakete geschnürt werden, machen nur rund zehn Prozent dessen aus, was allein am amerikanischen Aktienmarkt verloren worden ist. Der Kapitalmarkt wird weniger wichtig - die Party ist vorbei. Das gilt für Wertpapiere und erst recht für Finanzinvestoren und Hedge-Fonds. Unsere Studenten werden nicht mehr zu Gehältern eingekauft, die die Professorengehälter weit übersteigen.
Schon melden die ersten Unternehmen, sie bekämen keine Kredite mehr.
SCHMIDT: Wir haben eine viel größere Vorsicht bei der Kreditvergabe - aber das ist etwas Vernünftiges. Dass die Kreditversorgung zurückgegangen ist, lässt sich anhand der jüngsten Zahlen allerdings noch nicht belegen. Es könnte auch eine sehr stark empfundene Befürchtung sein.
Mit dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz wurde jetzt ein Sonderfonds - der Soffin - geschaffen, der über 100 Milliarden Euro an Krediten bereitstellen und Garantien über weitere 400 Milliarden aussprechen kann. Dazu werden Interventionsmöglichkeiten geschaffen und ein Konjunkturprogramm. Wie mächtig macht das Paket den Staat?
SPINDLER: Das Gesetz enthält erhebliche Befugnisse. Der politische Druck, zu handeln, war ja auch enorm. Ich halte das Gesetz teilweise für europarechtswidrig - etwa, wenn es Bezugsrechte der Altaktionäre außer Kraft setzt, für den Fall, dass der Staat Anteile übernimmt.
SCHMIDT: Ein Verstoß gegen Eigentumsrechte, aber ein sinnvoller.
SPINDLER: Darüber kann man nicht so hinweggehen. Auch die Einberufungsfrist für Hauptversammlungen kann bis auf einen Tag verkürzt werden. Laut EU-Recht müssen es mindestens zwei Wochen sein. Beim Ausgliedern von faulen Forderungen in eine eigene Bank - eine sogenannte Bad Bank - fallen sämtliche Zustimmungsvorbehalte oder Datenschutzregeln weg. Es gibt sogar eine Generalermächtigungsnorm dafür, dass der Staat durch Auflagen jeder Art festlegen kann, wie die Bank ihre Geschäfte zu führen hat. Das Finanzministerium kann nach Belieben schalten und walten.
Ist die Teilverstaatlichung der Commerzbank gerechtfertigt?
SPINDLER: Davon, dass diese Bank illiquide war, hatte ich vorher - abgesehen von den teuren Übernahmeplänen für die Dresdner Bank - noch
nichts gehört. Ich habe Zweifel, ob der Staat der bessere Kapitalmarktteilnehmer ist.
Sogar Josef Ackermann entdeckt wieder die Vorzüge der Deutschland AG. Er hat angeregt, dass sich Banken wieder stärker in Unternehmen engagieren sollten.
SCHMIDT: Das ist in der Tat hoch spannend und zeigt, dass Herr Ackermann durchaus nachdenklich und selbstkritisch ist.
Bekommen wir die Deutschland AG zurück?
SCHMIDT: Wir gehen sicher ein Stück zurück. Alte Traditionen werden neu belebt. Der Staat will die Unternehmen jetzt vor allem mit dem zweiten Rettungspaket in die Lage versetzen, qualifizierte Mitarbeiter in der Krise nicht zu entlassen, sondern zu halten. Es gibt einen Konsens, die Arbeitsbeziehungen langfristig zu stabilisieren.
Die Arbeitnehmer sehen sich als Verlierer. Woher sollen sie das Vertrauen nehmen, dass jetzt alles gut wird?
SCHMIDT: Die Krise trifft sehr, sehr viele. Die Reallohnentwicklung der letzten Jahre war für die Arbeitnehmer schon nicht besonders toll - auch wenn der Rückgang der Arbeitslosigkeit ein bemerkenswerter Fortschritt war. Ohne die Krise wären jetzt eine Phase der Umverteilung und bessere Tarifabschlüsse dringend geboten gewesen. Das ist nun vorbei.
SPINDLER: Wenn eine Erholungsphase so abrupt endet, zahlen die Arbeitnehmer einen Teil der Zeche für die hohen Gewinne. Denn die Tarifpolitik läuft dem Konjunkturzyklus um bis zu zwei Jahre hinterher.
Viele Arbeitnehmer haben Angst um ihren Arbeitsplatz.
SPINDLER: Die Krise ist keine Spekulationskrise, so dass nun Schadenfreude angesagt wäre. Die Krise hat Kapital vernichtet, Wohlstand zerstört und erfasst nun die reale Wirtschaft. Erst gehen die Leiharbeiter. Wenn das nicht reicht, kommt die Kernbelegschaft dran: Kurzarbeit, dann Entlassungen. Unrentablen Unternehmensstandorten geht zuerst die Puste aus, dann folgt im schlimmsten Fall der ganze Laden.
Oft hört man: Die Banken werden mit Milliarden gerettet, die Menschen bekommen nichts.
SCHMIDT: Das stimmt so nicht. Den Arbeitnehmern wird das Geld nicht ausgezahlt. Aber selbstverständlich profitieren sie mittelbar - etwa, wenn ein Unternehmen und damit Beschäftigung gerettet wird. Mit der Intervention des Staates ist auch eine Rückkehr zu substanzorientiertem realwirtschaftlichem Denken verbunden - eine Wende in Richtung Deutschland-AG-Philosophie. Die Unternehmen sollen wieder vernünftige Produkte herstellen und nicht nur Gewinne machen. Damit einher geht auch eine Wende zu einer arbeitnehmerfreundlicheren Politik.
Das klingt gut. Aber die Leute fragen sich, wie eine Krise, die ihren Kern in den USA hatte, auch hier so massiv durchschlagen konnte.
SCHMIDT: Das hängt mit der internationalen Verflechtung der Märkte zusammen - aber nicht nur. Erinnern wir uns: Es gab eine Zeit, in der das Finanzministerium stolz darauf war, dass es immer neue Finanzinnovationen möglich machte. Es herrschte eine Deregulierungsideologie, gepaart mit Finanzchauvinismus. Ganz nach dem Motto: Die Party soll nicht ohne uns stattfinden. Bei der IKB saß Jörg Asmussen selbst im Aufsichtsrat, der als Abteilungsleiter beim Finanzministerium für die Regulierung gerade der Instrumente zuständig war, die bei der IKB die Krise verursacht haben.
In der Tat: Die öffentliche Hand hat sich auch keine großen Verdienste erworben.
SCHMIDT: Es ist vielleicht kein Zufall, dass es gerade öffentliche Banken waren, nämlich Landesbanken, die mit solchen Geschäften zwischen 2001 und 2007 sehr viel verdient haben - was sie vielleicht brauchten, um die marode Schuhindustrie in der Pfalz stützen zu können. Da gab es längst Warnungen vor den allzu riskanten Geschäften - aber hohe Beamte im Finanzministerium haben, so hörte ich, dann die BaFin zurückgepfiffen.
Wann kippte die Stimmung?
SCHMIDT: Auf der Euro Finance Week in Frankfurt im November 2008 erklärte Josef Ackermann, er habe sich - wie auch die Leute im Finanzministerium - immer dagegen gesträubt, dass die Bankenaufsicht die Geschäftsmodelle der Banken prüfen solle. Jetzt sei er anderer Meinung. Das war ein Wendepunkt. Interessanterweise ist ja auch fast zeitgleich die massive Kritik aus Brüssel an den Sparkassen verstummt.
Auch Sie sprechen den Finanzinvestoren die ökonomische Rationalität nicht ab - von Einzelfällen abgesehen, die eben den Bogen überspannen. Was macht Sie so sicher, dass wir es nicht doch mit einer Systemkrise zu tun haben?
SCHMIDT: Wenn es etwas Systemisches in dieser Krise gibt, dann die kaum noch hinterfragte Erwartung an wahnsinnig hohe Renditen. Da haben viele mitgemacht. Aber der schlichten Ausbeutungstheorie fehlt die ökonomische Logik. Die Vorstellung, dass eine Heuschrecke etwas kahl frisst, sich dabei fast den Magen verdirbt und dann aussteigt, ignoriert, dass diese Finanzinvestoren sich immer darauf ausrichten, ihre Beteiligungen zu einem hohen Preis wieder zu verkaufen. Das geht nicht, wenn man sie vorher zugrunde gerichtet hat.
Dumm nur für die Unternehmen, die jetzt auf einem riesigen Schuldenberg sitzen und möglicherweise in der Krise vor der Insolvenz stehen. Wer definiert da die ökonomische Rationalität?
SCHMIDT: Ein Unternehmen mit so viel Schulden zu belasten, dass es zusammenbricht, ist auch für die Investoren eine pure Katastrophe - auch wenn sie diese Katastrophe nicht so berühren mag wie die Folgen für die dann arbeitslosen Arbeitnehmer. Eine optimale Verschuldungsquote für ein Unternehmen gibt es nicht.
Die angelsächsische Vorstellung von Corporate Governance, nach der der Vorstand ausschließlich den Aktionären zu dienen hat, hat das mitbestimmte deutsche Modell unter Druck gesetzt.
SPINDLER: Ja. Besonders große Probleme gibt es immer, wenn zwei Systeme, die einen eigenen Entwicklungspfad hinter sich haben, aufeinandertreffen und inkonsistente Mischsysteme entstehen. Wenn sich zwei Kontinentalplatten aneinander reiben - dann entsteht ein Erdbeben.
SCHMIDT: Das angelsächsische und das kontinentale Modell kennen jeweils andere Kontrollsysteme. Die kontinentalen Strömungen stehen einer politischen Ökonomie sehr viel näher als die angelsächsischen.
SPINDLER: Es ist ökonomisch falsch, die Shareholder-Philosophie auf Quartalsberichte zu reduzieren. Diese Einsicht gewinnt nun an Boden.
Herr Spindler, Sie schlagen in einem Gutachten für die Stiftung vor, die "interessenpluralistische Unternehmensleitlinie" - wie es da heißt - im Aktiengesetz zu präzisieren. Sie soll das Unternehmen auf das Interesse der Arbeitnehmer und der Allgemeinheit verpflichten. Was versprechen Sie sich davon?
SPINDLER: Viele meiner Kollegen haben zuletzt den Shareholder-Value in seiner einfachsten Form propagiert. Im Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) von 1998 gibt es die Formulierung, dass es ein legitimes Interesse sei, den Unternehmenswert zu fördern. In dieser einfachen Form war das schon vor zehn Jahren nicht meine Auffassung.
SCHMIDT: Das gilt auch für mich.
SPINDLER: Zwar hat die Rechtsprechung tapfer betont, dass der Vorstand verschiedene Interessen zu berücksichtigen hat - faktisch aber ist das Belegschaftsinteresse immer mehr aus dem Blickfeld geraten. Eine Gemeinwohlklausel wieder aufzunehmen heißt, etwas Selbstverständliches gegen einen gewissen Interpretationstrend zu kodifizieren.
Dass das Vorgänger-Gesetz von 1937 stammt, stört Sie nicht?
SPINDLER: Die Idee der Gemeinwohlorientierung reicht zurück bis in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg - sie ist weit entfernt von irgendeiner braunen Ideologie. Darum wehre ich mich gegen diese Argumentation. Der Referentenentwurf des Reichsjustizministeriums für die Gesetzesreform 1937 stammt aus dem Jahr 1930, also aus der Zeit der großen Wirtschaftskrise. Da ist hinterher doch nur braune Soße drübergegossen worden.
SCHMIDT: Die Formulierung mit Volk, Reich und Führer war nach 1945 politisch nicht korrekt. Aber der Grund, die Gemeinwohlklausel 1965 zu streichen, war, dass man sagte: Überflüssiges braucht man nicht in ein Gesetz zu schreiben. Das Wort "Gemeinwohl" ist nicht per se nationalsozialistisch. Umgekehrt nehmen manche Leute das Fehlen einer solchen Formulierung als Bestätigung, dass eine Aktiengesellschaft nichts als eine Einrichtung zum Wohle der Aktionäre sei. Und das ist nicht richtig.
SPINDLER: Das eigentliche Problem ist, welche Interessen in welchem Umfang berücksichtigt werden, damit es nicht ins Uferlose geht. Ich kann mir aber eine Formulierung wie diese vorstellen: Der Vorstand hat auch die Interessen der Belegschaft und der Allgemeinheit zu berücksichtigen.
Um die Finanzinvestoren ist es erst einmal ruhig geworden. Aber die nächste Hochkonjunktur kommt - hoffentlich. Sind die Arbeitnehmer dann besser gewappnet?
SPINDLER: Das neue Risikobegrenzungsgesetz hat einige Verbesserungen gebracht - etwa Informationsrechte des Wirtschaftsausschusses oder des Betriebsrates gegenüber dem Arbeitgeber. Aber es schafft keine Rechte gegenüber dem Investor. Es ist in der Praxis für die Belegschaften kaum das Papier wert, auf dem es gedruckt ist.
Das Risikobegrenzungsgesetz verdient in Ihren Augen seinen Namen nicht. Welche konkreten Instrumente hätten Sie sich gewünscht?
SPINDLER: Das Gesetz ist im Prinzip ein erster richtiger Schritt, indem man versucht, die Transparenz auf Kapitalmärkten zu verbessern. Auch das Acting-in-Concert als Regelung für das Zusammenwirken von Investoren ist verbessert worden; allerdings hätten wir uns Regelungen gewünscht, die die zulässigen von den unzulässigen Fallgruppen besser unterschieden hätten. Für die Arbeitnehmer steht nach wie vor das Problem im Raum, dass sie grundsätzlich nur mit "ihrem" Arbeitgeber zu tun haben, der gerade eben aber übernommen wird durch Finanzinvestoren - mit denen die Arbeitnehmer nicht verhandeln können. In einem neuen Gutachten für die Hans-Böckler-Stiftung will ich deshalb zusammen mit dem Arbeitsrechtler Rüdiger Krause untersuchen, ob konzernweite Vereinbarungen wie Change-of-Control-Klauseln denkbar sind - mit bitteren Pillen für Investoren. Dass also bestimmte Rechte automatisch greifen, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse im Unternehmen ändern.
Wie könnte das konkret aussehen?
SPINDLER: Darüber zu spekulieren wäre verfrüht. Der Clou wäre beispielsweise, dass solche Vereinbarungen in Form eines konzernweiten Tarifvertrags dann auch per Arbeitskampf durchgesetzt werden könnten. Damit wären wir auch europäisch anschlussfähig. Die Verhandlungen, wie sie bei der grenzüberschreitenden Verschmelzung oder Konzernumstrukturierung stattfinden, könnten eine Blaupause sein.
Einen Segen hat die Krise womöglich doch: Sie bereichert die ökonomische Debatte.
SCHMIDT: Zweifellos. Das Interesse an europäischen Modellen ist gerade auch in den USA gestiegen. Der Microsoft-Gründer Bill Gates hat kürzlich beim World Economic Forum in Davos einen sanfteren, kreativen Kapitalismus, eine Art sozialer Marktwirtschaft, gefordert und viel Resonanz erzielt. Für intellektuell aufgeschlossene Leute auf beiden Seiten des Atlantiks wird der ökonomische Diskurs wieder interessanter. Vor allem beobachte ich in den USA ein gestiegenes Interesse an unseren institutionellen Regelungen. Das gilt auch für die Themen staatliche Interventionen oder Arbeitnehmerschutzrechte. Der Wind hat sich vollkommen gedreht. So schlimm die Krise ist - politisch bringt sie in jedem Fall die Chance zum Aufwachen.
Wagen Sie eine Prognose für die Bundestagswahl?
SCHMIDT: Nein, das ist mir viel zu gefährlich! Da spielen zu viele Faktoren mit. Ich vermute, dass die Krise - anders als die viel schwerere von 1930 - weder das System noch das Parteienspektrum massiv verändert. Aber sie wird das Denken in den Parteien selbst verändern.
zur Person
REINHARD H. SCHMIDT, 62, gilt als Fachmann für Instititionenökonomie und den internationalen Vergleich von Bank- und Finanzsystemen in Industrie- und Entwicklungsländern. Er hält den Stakeholder-Ansatz auch ökonomisch für ebenso sinnvoll wie den Shareholder-Ansatz und in einem rechtlichen und gesellschaftlichen Kontext wie in Deutschland möglicherweise sogar für überlegen. Seit 1998 ist er Professor für Internationales Bank- und Finanzwesen an der Universität Frankfurt. Vorher hatte er Professuren in Göttingen, Trier und Washington inne. Wie Spindler ist er auch als Gutachter für die Hans-Böckler-Stiftung tätig.
zur Person
GERALD SPINDLER, 48, hat Jura und Ökonomie studiert und beschäftigt sich unter anderem mit der Regulierung von Kapitalmärkten. Seit 1997 ist er Professor für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung, Multimedia- und Telekommunikationsrecht an der Universität Göttingen. Spindler hat sowohl den deutschen als auch den europäischen Gesetzgeber beraten. Seit mehr als zehn Jahren publiziert er immer wieder gemeinsam mit Reinhard H. Schmidt - zuletzt die im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung erstellte Studie "Finanzinvestoren aus ökonomischer und juristischer Perspektive", die 2008 bei Nomos erschienen ist.
Zitate
"Mit der Intervention des Staates ist eine Wende in Richtung Deutschland-AG-Philosophie verbunden."
Reinhard H. Schmidt
"Das Risikobegrenzungsgesetz ist in der Praxis für die Belegschaften kaum das Papier wert, auf dem es gedruckt ist."
Gerald Spindler