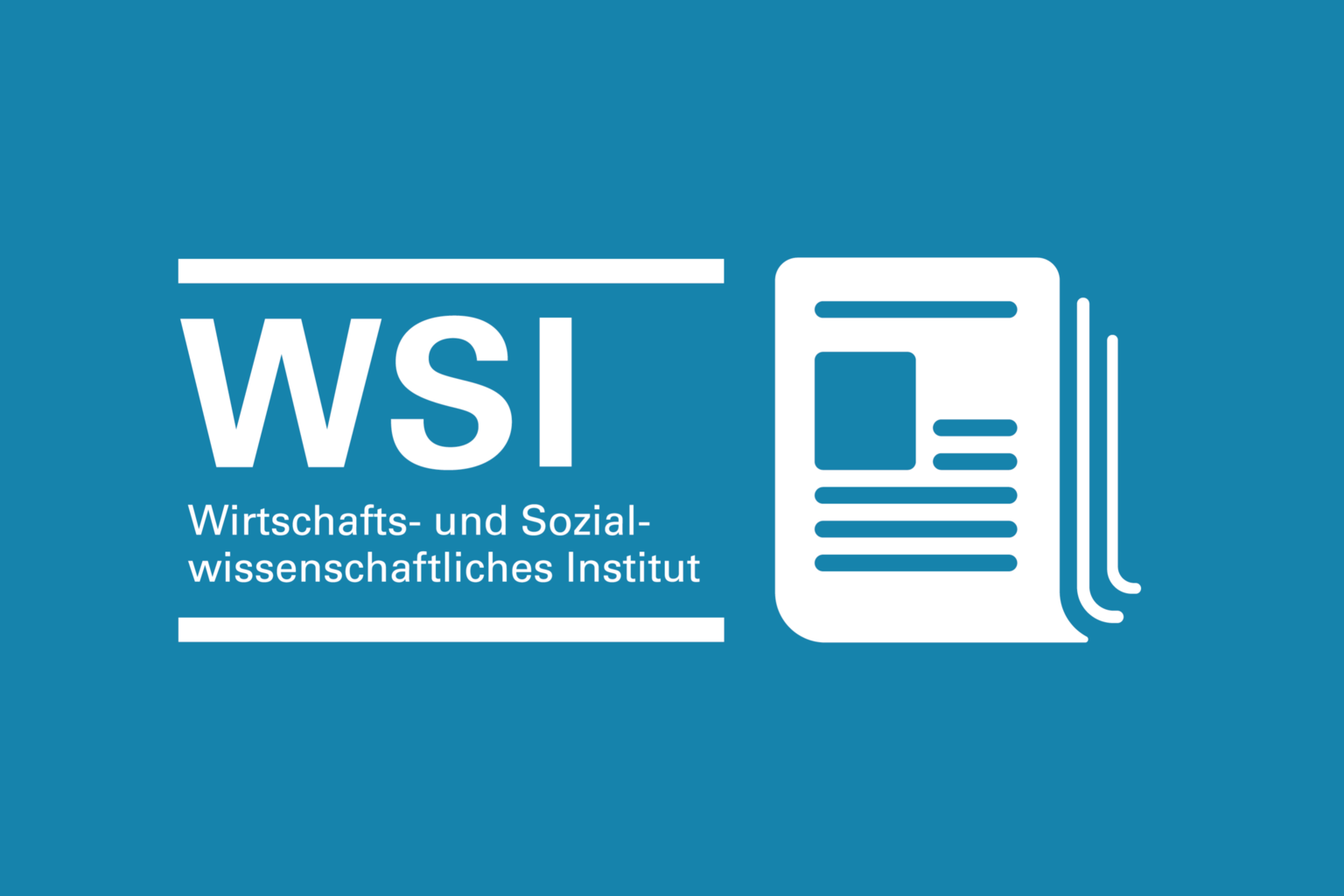Tagungsbericht Böckler Konferenz für Aufsichtsräte 2025: Eine neue Systemkonkurrenz
Trump, China, Transformation: Auf der Böckler Konferenz für Aufsichtsräte in Berlin ging es um Orientierung und Vertrauen in bewegten Zeiten.
[13.06.2025]
Von Kay Meiners
Die Eröffnungsrede, die Daniela Cavallo, die Vorsitzende des VW-Konzern- und Gesamtbetriebsrates hielt, führte direkt hinein ins Herz der Mitbestimmung und die aktuellen Probleme des Standortes. VW gilt als Leuchtturm der Mitbestimmung, doch jetzt ist die Stimmung ernst. „Es gibt keine Kolleginnen, keine Kollegen, die nicht verunsichert sind“, erklärte Cavallo. Der Druck, der auf dem nach Umsatz größten Autohersteller der Welt und den Beschäftigten laste, sei „enorm.“
Das Unternehmen baut heute etwa 2 Millionen Fahrzeuge weniger im Jahr als vor der Corona-Pandemie – es sind noch 9 Millionen Stück. VW muss gleichzeitig seine Verbrenner-Modelle aktuell halten, beim E-Auto weiter aufholen und sich länger als prognostiziert mit hybriden Antrieben beschäftigen – in einer Zeit, in der der Kuchen für die ganze Branche schrumpft.
Nicht nur, dass die geopolitischen Risiken zunehmen, viele Ökonomien sich abschotten und sich neue politische Allianzen bilden. Das Management will auch sparen. Unter diesen Vorzeichen sei die Mitbestimmung wichtiger als jemals zuvor, sagte Cavallo: „Wenn wir jetzt die Entscheidung der Kapitalseite überlassen, steht das Ergebnis fest.“ Cavallo kündigte an, für die Arbeitsplätze zu kämpfen – und für eine langfristige Perspektive, die über die Laufzeiten der Vorstandsverträge hinausgeht. Dafür erntete sie heftigen Applaus.
In einer anschließenden Podiumsdiskussion zur Wettbewerbsfähigkeit traf sie auf Felix Banaszak, den Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, der sichtlich um Anschlussfähigkeit bemüht war und laut über eine Förderung von E-Autos nach sozialen Kriterien nachdachte, auf Alexandra Krieger von der IGBCE - und auf Alexander Dibelius von CVC Capital Partners. Der Vertreter der Private-Equity-Branche outete sich als „Fan der Mitbestimmung “- schließlich gehe es um „die beste Lösung“ für die Unternehmen. Unterschiedliche Perspektiven im mitbestimmten Aufsichtsrat trügen dazu bei.
Dibelius betonte, auch die Anteilseigner seien verunsichert. Einigkeit herrschte darüber, dass am Ende Produkte und Produktionsbedingungen wettbewerbsfähig sein müssen, doch ging Krieger die demonstrative Harmonie zu weit: „Es gibt einen Interessengegensatz.“ Das Kapital könne einfach ins Ausland gehen, „die Beschäftigten müssen bleiben.“
Europa will nachhaltig werden
Am Nachmittag des ersten Tages ging es um das Thema Nachhaltigkeit – ein Begriff, der nur mehrdimensional mit Inhalt zu füllen ist, wie Kerstin Lopatta, BWL-Professorin aus Hamburg, erklärte. Denn das Thema habe eine ökologische, soziale und unternehmerische Dimension. Ein Appell an die Aufsichtsräte, kritische Fragen zur Risikobewertung in jede Richtung zu stellen. „Ein guter Aufsichtsrat sieht den Eisberg, bevor der Kapitän ihn sieht“, sagte Christoph Meister, Mitglied im Ver.di-Bundesvorstand. Meister erinnerte aber auch an die zahlreichen Unternehmensleitungen, die mittlerweile Mitbestimmung der Beschäftigten im Aufsichtsrat aushebeln. Lücken in den einschlägigen Gesetzen machen es ihnen leicht, wie Studien des I.M.U. der Hans-Böckler-Stiftung immer wieder zeigen. Die zu schließen, sei eine wichtige Aufgabe für die neue Regierung, betonte Meister.
Alexandra Schädler, Nachhaltigkeitsexpertin am I.M.U. der Hans-Böckler-Stiftung, informierte über die Chancen einer modernen Nachhaltigkeitsberichterstattung, in die alle Anspruchsgruppen eingebunden werden: „Nur, was messbar gemacht wird, bekommt das Potenzial für Veränderungen“. Freilich sind solche Berichte, wie sie die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU regeln soll, noch freiwillig. Denn es fehlt ein nationales Umsetzungsgesetz. Für die Kapitalseite erklärte Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit & Corporate Governance bei Deka Investment und Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex, dass solche Berichte auch interessant für Risikobewertungen durch Investoren sind. Allerdings geht auf EU-Ebene unter dem Motto „Bürokratieabbau“ der Trend eher dahin, Berichtsanforderungen zusammenzustreichen.
Plötzlich sind die USA ein Problem
In den USA gehen manche Uhren erst recht rückwärts – auch in Sachen Nachhaltigkeit. Am Nachmittag des ersten Konferenztages gab Heike Buchter, die als Wirtschafts- und Finanzjournalistin in New York lebt, einen Eindruck davon, wie die Trump-Administration gerade die Axt an die ESG-Kriterien und an Diversity-Programme anlegt. Die Kürzel „ESG“ (Environmental, Social, and Governance) und „DEI“ (Diversity, Equity, and Inclusion), die gestern noch populär waren, sind für die Trump-Regierung ein Ärgernis. Konservative Social-Media-Aktivisten wie Robby Starbuck prägten diesen Kurs mit.
Für deutsche Unternehmen bedeutet das einige Kapriolen. Denn der Staat mischt in den USA durchaus stark in der Wirtschaft mit. Zwischen Opportunismus, pragmatischem Taktieren und der eigenen Werthaltung müssen die Unternehmen ihren Weg finden.
Ein Thema auch in den Aufsichtsräten. Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi gab sich an diesem Punkt kämpferisch: „Wir unterscheiden nicht zwischen Hautfarbe, Religion oder Geschlecht. Neutralität gegenüber so einer Politik kann keine Lösung sein“. Verschiedene Vorschläge wurden in den Raum gestellt: Talente abwerben, neue Märkte jenseits der USA erschließen. Heike Buchter aber blieb skeptisch: „Es wird ein harter Weg für Europa.“
Heiße Diskussionen in den Workshops
Am zweiten Tag, in den Workshops, war Mitmachen angesagt. Die neuen geopolitischen Herausforderungen waren dabei ein wichtiges Thema. Während viele Unternehmen weiter einem Verlagerungsdruck ausgesetzt sind, lassen Zoll-, Wechselkurs- und Lieferkettenrisiken Unternehmen zusätzlich zu regional angepassten Strategien oder Local-for-Local-Konzepten greifen. Komplexe Lieferketten, in denen Vorprodukte aus einem Kontinent auf einem anderen verarbeitet und auf einem dritten verkauft werden, gelten als kaum noch kalkulierbar.
Die deutlich höheren Gaspreise für die Industrie in der Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine und billige Konkurrenz aus China führen in Deutschland zu sinkenden Margen und mehr Wettbewerbsdruck. Das kann dazu führen, dass ganze Konzerne zerschlagen und auf margenstarke Kerne geschrumpft werden, wie in der Stahl- und auch Chemiebranche zu beobachten. So mancher hat Angst, China könnte Europa nicht nur preislich, sondern auch technisch überholen.
Eine Hoffnung der Aufsichtsratsmitglieder richtet sich angesichts der neuen Systemkonkurrenz auf eine faire Risiko-Beurteilung, von der die heimischen Standorte profitieren könnten: Je erratischer die USA, je unzugänglicher China, desto eher könnte die EU als verlässlicher Wirtschafts- und Investitionsraum dastehen. Doch dazu muss die Politik ihren Beitrag leisten. Vielen klingt im Ohr, was Thomas Fischer, Abteilungsleiter Grundsatz und Gute Arbeit beim DGB-Bundesvorstand, am Morgen gefordert hat: „Damit die Mitbestimmung Vertrauen schaffen kann, brauchen wir eine Politik, die Planungssicherheit für die Unternehmen schafft.“