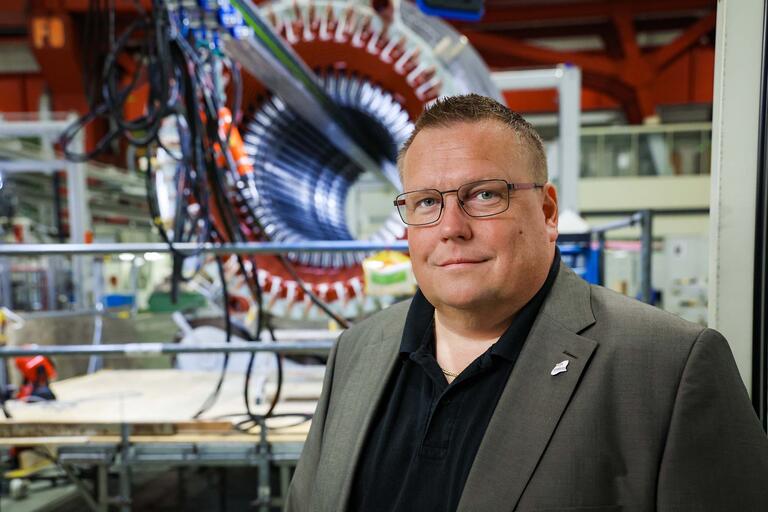: Griff in den Himmel
ANFÄNGE Nach dem Krieg verlangten die Gewerkschaften einen echten Ausgleich zwischen Kapital und Arbeit. Die Montanindustrie sollte nur der Motor eines weiter gehenden Umbaus sein - hin zu einer solidarischen Wirtschaftsweise. Von Andreas Molitor
ANDREAS MOLITOR ist Journalist in Berlin/Foto: ullsteinbild
Hans-Eberhard Urbaniak redet immer noch jene Sorte Klartext, die in jeder Eckkneipe verstanden wird. Vor Kurzem hat der langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete aus Dortmund-Dorstfeld seinen 82. Geburtstag gefeiert, doch von seinem Furor hat er nichts verloren. Ob das Management auch auf seiner Zeche gegen die Mitbestimmung agitiert hat, damals, in jenen Kampftagen, als er noch im Pütt unter Tage arbeitete? Der alte Gewerkschafts-Haudegen versteht gar nicht, wie man so etwas fragen kann. "Bei uns gab es kein Störfeuer", sagt er dann in breitem Ruhrpott-Tonfall. "Die wussten doch: Wer hier auf'm Pütt die Schnauze aufmacht, kann nur eins draufkriegen." So war das damals auf Zeche Dortmund-Dorstfeld und an vielen anderen Orten. "Bei Stahl und Kohle waren die Gewerkschaftspfeiler fest eingerammt", so formuliert es Hans-Eberhard Urbaniak. Aber eben nur dort. Anderswo, etwa in Textilfabriken, Autoschmieden, Chemieküchen und erst recht in den Wirtschaftsverbänden, regte sich erbitterter Widerstand gegen ein aus Unternehmersicht bedrohliches Ansinnen: die gesetzlich verankerte Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den großen Unternehmen.
Im Jahr 1950 bahnte sich ein monatelanger Streit an um die Gleichberechtigung von Kapital und Arbeit; es wurde die vielleicht schärfste Auseinandersetzung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern in der Bundesrepublik. Denn die Wirtschaftsbosse sperrten sich dagegen, dass die Malocher ihnen künftig reinreden sollten. Unter den Vorzeichen des Kalten Krieges stilisierten sie ihre Fundamentalopposition gegen die Mitbestimmung zum Versuch, "einen geistigen Damm für die Sicherstellung der westlichen Kulturwelt gegen den Osten zu errichten". Große Worte. Dabei hatten die meisten Gewerkschafter, jedenfalls die nicht-kommunistische Mehrheit, mit dem Osten gar nicht viel im Sinn. Aber sie waren selbstbewusst geworden. Die Arbeiter und nicht die Zechenbosse und leitenden Angestellten, von denen viele entweder im Gefängnis saßen oder von den Alliierten nach Hause geschickt worden waren, hatten nach dem Krieg die Zechen und Stahlwerke wieder ans Laufen gebracht und Demontagen verhindert.
BETRIEBSRÄTE ALS ORDNUNGSMACHT_ Auch auf dem Pütt Dortmund-Dorstfeld wurde eine große Küche eingerichtet, die Gratis-Essen für die Kohlekumpel ausgab; nach der Schicht konnten die Arbeiter Verpflegungspakete mit nach Hause nehmen. "Das hat alles der Betriebsrat organisiert", erinnert sich Urbaniak. Wenn ein Kumpel krank war, wer besuchte ihn im Krankenhaus? Der Mann von der Gewerkschaft. Und wenn ein Kollege starb, wer half der Witwe bei den Rentenformularen? Der Mann von der Gewerkschaft.
Im Ruhrgebiet hatten die Gewerkschaften schon ermutigende Erfahrungen mit der Mitbestimmung gemacht. Unter dem Hoheitsrecht der Besatzungsmächte und im Zuge der angeordneten Entflechtung der Eisen- und Stahlindustrie war ihnen Anfang 1947 gelungen, eine Parität der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten und die Einsetzung eines für Arbeits-, Sozial- und Personalpolitik zuständigen Arbeitsdirektors durchzusetzen. Die Montanarbeitgeber hatten zugestimmt - nicht zuletzt weil sie hofften, mit der Unterstützung der Arbeitnehmer Demontagen oder Enteignungen besser verhindern zu können. "Ohne die Arbeitnehmervertreter lief gar nichts", erinnert sich der spätere Dortmunder Oberbürgermeister Günter Samtlebe, der damals als junger Mann am Hochofen im Hoesch-Stahlwerk Dortmund-Hörde stand. "Das hätte sich auch keiner gefallen lassen. Die Arbeiter hatten durch den Krieg so die Schnauze voll, dass ihnen der Respekt vor diesen Brüdern vergangen war."
DER RUF NACH DEM GESETZ_ Diese Errungenschaften, allen voran die Parität von Kapital und Arbeit im Aufsichtsrat, wollten die Gewerkschaften unverrückbar gesetzlich festschreiben lassen - nicht beschränkt auf Eisen und Stahl, sondern für alle Wirtschaftszweige. Der DGB-Gründungskongress im Oktober 1949 hatte verlangt, dass "die Aufsichts- und Verwaltungsorgane der Großindustrie nicht mehr ausschließlich durch die Vertreter des Kapitals bestimmt, sondern dass Vertreter der Arbeitnehmerschaft durch ihre gewerkschaftlichen Organisationen maßgeblich eingeschaltet werden". Wenn es jetzt nicht gelinge, die Gleichberechtigung von Kapital und Arbeit unverrückbar zu verankern, erklärte Walter Freitag, IG-Metall-Chef und späterer DGB-Vorsitzender, Anfang Januar 1950, "haben wir aufgehört, als Gewerkschaften überhaupt zu einer Bedeutung zu kommen".
Für den amtierenden DGB-Vorsitzenden Hans Böckler gehörte die Mitbestimmung unverzichtbar zur Demokratisierung der Wirtschaft. Es sei an der Zeit, die Arbeitnehmer endlich als gleichberechtigte Wirtschaftsbürger anzuerkennen. In seiner Rede zum 1. Mai 1950 bezeichnete Böckler die Mitbestimmung sogar als "heiliges Recht". Er bekräftigte den Willen der Gewerkschaften, "hinauszugreifen in den Himmel und herabzuholen jene Rechte, die droben hängen, unveräußerlich und unzerbrechlich wie die Sterne selbst".
Die Unternehmer wollten Herr im Haus bleiben. Schnell wurde klar, dass es allein mit ihnen - ohne Vermittlung der Bundesregierung, die sich vorerst abseits hielt - keine Einigung geben würde. Die Entsendung von Gewerkschaftsvertretern in die Aufsichtsorgane der Unternehmen bedeutete für die Arbeitgeber "eine Machtzusammenballung im DGB, der in der Wirtschaftsgeschichte einmalig" sei. Solcherlei musste schließlich "im Kollektivsystem und damit im Ende unternehmerischer Initiative und privatwirtschaftlicher Ordnung" enden. Maximal ein Drittel der Sitze in den Aufsichtsräten wollten sie den Arbeitnehmern zubilligen.
ZWEI LAGER IM DGB_ Der Front der Arbeitgeber begegnete der DGB nicht von Anfang an mit einem Konzept aus einem Guss. Innerhalb der Gewerkschaften gab es widerstreitende Interessen. "Offenbar bestand anfangs keine Klarheit darüber, wie die allgemeine Forderung nach der Demokratisierung der Wirtschaft konkret umgesetzt werden sollte", schreibt der Böckler-Biograf Karl Lauschke. "Sogar führende Funktionäre hatten nur unklare Vorstellungen von der Art und Weise, wie die Mitbestimmung in den Unternehmen geregelt werden sollte."
Zwei Fraktionen standen sich gegenüber. Die eine, angeführt von dem sozialistischen Ökonomen Viktor Agartz, dem Leiter des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts des DGB (WWI), knüpfte an Konzepte zur Wirtschaftsdemokratie aus der Vorkriegszeit an und favorisierte eine gesamtwirtschaftliche Mitbestimmung in Kammern, Räten und Ausschüssen. Die Gegenposition bezog der pragmatische Betriebswirt Erich Potthoff, der eine Zeit lang gemeinsam mit Agartz das WWI leitete. Potthoff, der sich schließlich durchsetzte, hielt die Vertretung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten für wichtiger als Debattenforen auf nationaler Ebene. Auch die Teuerung bei Lebensmitteln - im Sommer 1950 durchschnittlich 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - war manchem Gewerkschafter wichtiger als die eher abstrakte Mitbestimmung. Vertreter der süddeutschen Landesbezirke plädierten dafür, "der Preisfrage, die eine Magenfrage ist, im gegenwärtigen Zeitpunkt vor den Mitbestimmungsforderungen den Vorrang" zu geben.
Solchermaßen uneins, gingen die Gewerkschaften nicht eben gestärkt in die Verhandlungen mit den Arbeitgebern. Als Böckler im Mai 1950 mehrere Herzinfarkte erlitt und an den Verhandlungen nicht teilnehmen konnte, ließen sich seine Unterhändler sogar von der Forderung nach strikter Parität abbringen. Mit einem Verhältnis von 40 zu 60 zugunsten der Kapitalseite könne man notfalls leben, signalisierten sie dem Verhandlungsgegner. Böckler intervenierte vom Krankenbett aus und wies die DGB-Delegation an, von der Parität künftig nicht den kleinsten Deut abzurücken. Er ahnte, dass auch die bisher praktizierte streng paritätische Regelung bei Eisen und Stahl keinen Bestand haben würde, wenn die Gewerkschaften in den Verhandlungen auf die völlige Gleichberechtigung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat verzichteten.
DIE REGIERUNG SCHALTET SICH EIN_ Nach dem endgültigen Scheitern der Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern schaltete sich die Bundesregierung ein. Angesichts der festgefahrenen Situation war dies alternativlos, ließ aber für die Gewerkschaften nichts Gutes erwarten. Weder Bundeskanzler Adenauer noch Wirtschaftsminister Erhard galten als Freunde der Mitbestimmung; ein erster Gesetzentwurf der Bundesregierung vom August 1950 lag weitgehend auf der Linie der Arbeitgeber.
Die Gewerkschaften erhöhten den Druck auf die Regierung. Die IG Metall beschloss für die Eisen- und Stahlindustrie eine Urabstimmung über Kampfmaßnahmen für den Fall, dass die Politik sich über die gewerkschaftlichen Forderungen hinwegsetzte. "Wir müssen nur das Herz haben, nicht zurückzuweichen vor den Angriffen, die, wenn wir etwas tun, zweifellos von allen Seiten auf uns niedergehen werden", bereitete Hans Böckler auf einer DGB-Vorstandssitzung im November 1950 auf das Kommende vor. "Wir müssen einen unerbittlichen und unnachgiebigen Kampf führen." Auf dem Stimmzettel für die Eisen- und Stahlarbeiter stand: "Wer für sein Menschenrecht und seine Freiheit kämpfen will, der stimme mit ,ja'."
Eisenwerke und Stahlhütten waren als Stätten der Urabstimmung bewusst gewählt worden. Nur hier war ein Durchbruch zu erhoffen; allenfalls von den Bergleuten war eine vergleichbare Schlagkraft zu erwarten. In den Zechen und Stahlwerken des Ruhrgebiets hatten die Arbeiter in der Vergangenheit besonders unter der Drangsal der Schlotbarone gelitten. Entsprechend groß war die Kampfbereitschaft. In anderen Gegenden und Wirtschaftszweigen, etwa in der süddeutschen Automobilindustrie oder in den Chemiewerken, wäre das Ergebnis einer Urabstimmung vermutlich nicht überzeugend ausgefallen. Die Gegenseite hätte eine Zustimmung von 60 oder 70 Prozent als ein Zeichen der Schwäche interpretieren können.
98 PROZENT ZUSTiMMUNG BEIM STAHL_ Auf die Stahlarbeiter war Verlass. 98 Prozent votierten für Kampfmaßnahmen. Die IG Bergbau, die kurz darauf mit einer eigenen Urabstimmung nachzog, erreichte 93 Prozent. Auf Hans-Eberhard Urbaniaks Zeche stimmten sogar 99 Prozent der Kumpel für einen Streik. Er selbst zog als Referent im Gewerkschaftsauftrag durchs Land und warb für die Mitbestimmung. "Ich hab' den Arbeitern erklärt, dass wir das Kapital der Arbeit, diese Erfahrung der Arbeitnehmerschaft aus dem täglichen Arbeitsleben, sortieren, bündeln und einsetzen müssen für die Entwicklung der Unternehmen. Wer auf dieses Potenzial verzichtet, muss ein Idiot sein." Das sieht er heute noch genauso. Da ein politischer Streik für die Mitbestimmung verboten war, verfiel Hans Böckler auf eine kühne Idee. Anstatt zu streiken, sollte jeder einzelne Beschäftigte zum 31. Januar 1951 seinen Arbeitsvertrag aufkündigen. Stahlwerke und Zechen würden dann stillstehen. Allein in der Dortmunder Hoesch-Westfalenhütte unterschrieben bis Mitte Januar 1951 mehr als 10 000 Beschäftigte die Kündigungslisten. Genau kann Günter Samtlebe sich daran nicht mehr erinnern. Das macht aber keinen Unterschied: "Als Arbeiter tat man das, was die Gewerkschaft sagte. Da gab's kein Zaudern und kein Zurückweichen."
SPITZENGESPRÄCH MIT DEM KANZLER_ Unter der Drohung, die gesamte westdeutsche Wirtschaft lahmzulegen, kam es am 11. Januar 1951 zu einem Spitzengespräch zwischen Hans Böckler und Bundeskanzler Konrad Adenauer. Man kam überein, dass es vorerst nur um eine Sonderregelung für Kohle und Stahl gehen könne, die keine Vorentscheidung für die Mitbestimmung in den anderen Branchen bedeute. Auch Böckler war mittlerweile zu der Einsicht gekommen, "dass man den Kreis der Gegner so klein wie möglich" halten solle und "erst das eine erreichen" müsse, um dann "zum Nächsten zu gehen".
Der Weg war frei für neue Verhandlungen. Noch im selben Monat verständigten sich die Gewerkschaften und Vertreter der Montanbranchen auf die Eckpunkte der künftigen Mitbestimmung in der Eisen- und Stahlindustrie sowie im Bergbau. Das Verhandlungsergebnis entsprach weitgehend den gewerkschaftlichen Forderungen: Im Aufsichtsrat würden Kapital und Arbeit fortan gleichgewichtig vertreten sein. Der "neutrale Mann", der in Patt-Situationen den Ausschlag gibt, sollte nur mit Zustimmung beider Seiten gewählt werden können. Außerdem würde ein Arbeitsdirektor, der nicht gegen das Votum der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat bestellt werden kann, den Vorstand komplettieren. Am 10. April 1951 wurde das Montanmitbestimmungsgesetz für alle Kapitalgesellschaften mit mehr als 1000 Beschäftigten im Bundestag mit großer Mehrheit verabschiedet.
Siegesstimmung kam nicht auf. Vielleicht ahnte Böckler schon, dass es nicht gelingen würde, die Montanregelung in künftigen Verhandlungen auf die übrige Wirtschaft zu übertragen. Fast prophetisch muten seine Äußerungen in einer Rede vor Vertrauensmännern im Dortmunder Phönix-Stahlwerk wenige Tage nach der Einigung mit den Arbeitgebern aus heutiger Sicht an: "Noch höhere Kampfziele werden noch höheren Einsatz von uns fordern", rief Böckler den Vertrauensleuten zu. Bis heute ist die Montanmitbestimmung die weitreichendste Form der Mitbestimmung geblieben.
Bis zum ersten schweren Angriff auf die Montanmitbestimmung vergingen nur vier Jahre. Hermann Reusch, Generaldirektor der Gutehoffnungshütte in Oberhausen, bezeichnete sie Anfang 1955 als "das Ergebnis einer brutalen Erpressung durch die Gewerkschaften". Er empörte damit die Arbeiterschaft und löste einen 24-stündigen Warn- und Proteststreik aus, dem sich im Ruhrgebiet mehr als 800 000 Arbeiter anschlossen. "Morgens um fünf standen wir am Werkstor", erinnert sich Hans-Eberhard Urbaniak, damals Betriebsratsvorsitzender seiner Zeche. "Es hätte ja sein können, dass Streikbrecher ins Werk wollen." Aber es kamen nur ein Dutzend Arbeiter. "Denen haben wir gesagt: Heut' is' nix mit Arbeit, geht nach Hause." Urbaniak und die Seinen konnten telefonisch Meldung an den Bezirksvorstand ihrer Gewerkschaft machen: "Kollegen! Unsere Schachtanlagen stehen zu 100 Prozent still!"
Damals dachte noch niemand an die Bewährungsprobe eines sozialverträglichen Sturkturwandels, der die Montanmitbestimmung bald ausgesetzt sein würde. Niemand hätte geglaubt, das bald Bilder sterbender Zechen und erloschener Hochöfen die Runde machen würden. Stahl und Kohle waren die Herzkammer der bundesdeutschen Wirtschaft. "Die Montanmitbestimmung war nicht für die Bewältigung von Strukturkrisen konzipiert", urteilt der Gewerkschaftshistoriker Karl Lauschke. "Sie war ein alternatives Unternehmensmodell."
Montanmitbestimmung damals und heute (Statistik als pdf zum Download)