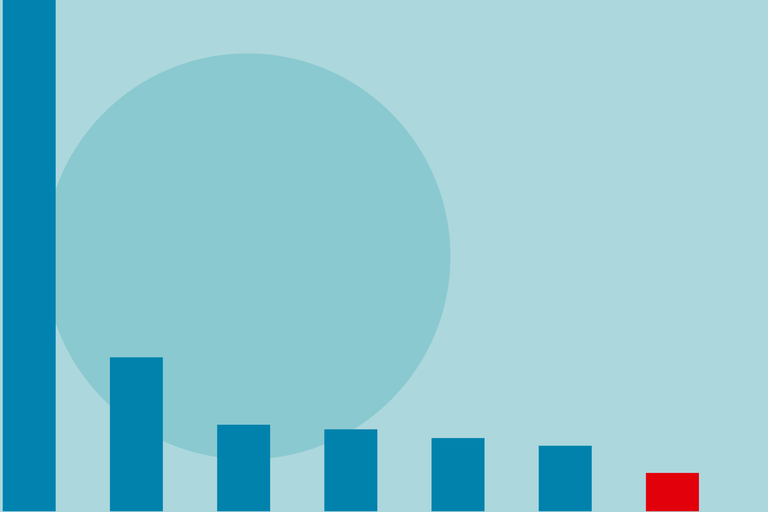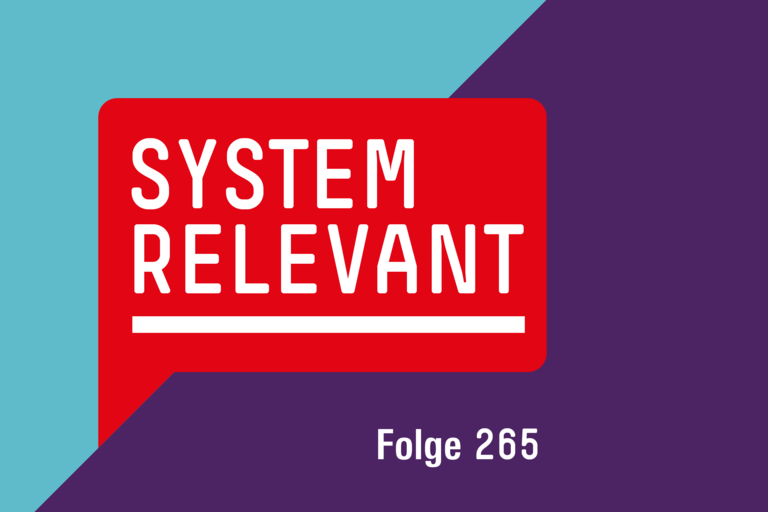Nachgefragt: Wirtschaftspolitik wird zum Machtinstrument
Wie sich die Weltordnung verändert und was das für Deutschland bedeutet, ordnet IMK-Direktor Sebastian Dullien ein.
Handelskrieg, Zölle, Protektionismus – erleben wir gerade das Ende der Globalisierung?
Ich weiß nicht, ob ich das direkt unterschreiben würde. Aber wir erleben schon grundsätzliche Verschiebungen. Lange Zeit haben die USA und China ihre Handels- und Wirtschaftspolitik darauf ausgerichtet, den ökonomischen Wohlstand ihrer Bürgerinnen und Bürger zu steigern. Das scheint nun nicht mehr an erster Stelle zu stehen. Diese Länder – und andere – sind stärker auf eine Konkurrenz um Macht eingeschwenkt und ordnen auch ihre Wirtschaftspolitik diesem Ziel unter.
Worum geht es konkret?
China hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit sowohl machtpolitisch als auch ökonomisch führend zu werden. So subventioniert es beispielsweise viele Branchen, die den Wohlstand des Landes vielleicht gar nicht so sehr steigern, aber wichtig sind, um militärische Macht zu erlangen oder um in bestimmten Bereichen unabhängig vom Rest der Welt zu werden. Die USA wollen ihre Führungsrolle behaupten und setzen dafür ebenfalls die Wirtschaftspolitik ein. So versuchen sie beispielsweise, Ausfuhren nach China zu begrenzen, auch wenn das dem eigenen Wohlstand eigentlich nicht zuträglich ist. Wenn die USA ihren Unternehmen beispielsweise verbieten, Halbleiter der neuesten Generation oder Fertigungsgeräte für Halbleiter nach China zu liefern, dann ist das nicht hilfreich für diese Unternehmen. Dahinter steht ein anderes Interesse.
Was bedeutet das für Deutschland und die EU?
Das ist für Deutschland und Europa schwierig, da sie lange Zeit sehr stark von einem offenen Weltmarkt profitiert haben. Die EU hatte nie Machtambitionen und hat sie auch heute nicht. Wenn die anderen aber mit dieser Motivation handeln, gerät man schnell ins Hintertreffen, wenn man nicht mitmacht.
Das klingt so, als müsste sich der Staat künftig viel stärker in die Wirtschafts- und Industriepolitik einmischen.
Ich glaube, eine große Stärke der sozialen Marktwirtschaft ist nach wie vor, dass Einzelne im Rahmen klarer Regeln und Rahmenbedingungen mit einer Idee erfolgreich sein und etwas anbieten können, wodurch sich das Leben aller verbessert. Der springende Punkt ist jedoch, dass das allein wahrscheinlich nicht mehr ausreicht. Der Staat muss in bestimmten Bereichen stärker eingreifen und bestimmte Aktivitäten stärker fördern, ohne dass dadurch die Marktwirtschaft grundsätzlich infrage gestellt wird.
Newsletter abonnieren
Alle 14 Tage Böckler Impuls mit Analysen rund um die Themen Arbeit, Wirtschaft und Soziales im Postfach: HIER anmelden!
Sebastian Dullien über „Deutschland und die neue Weltordnung“ im Podcast.