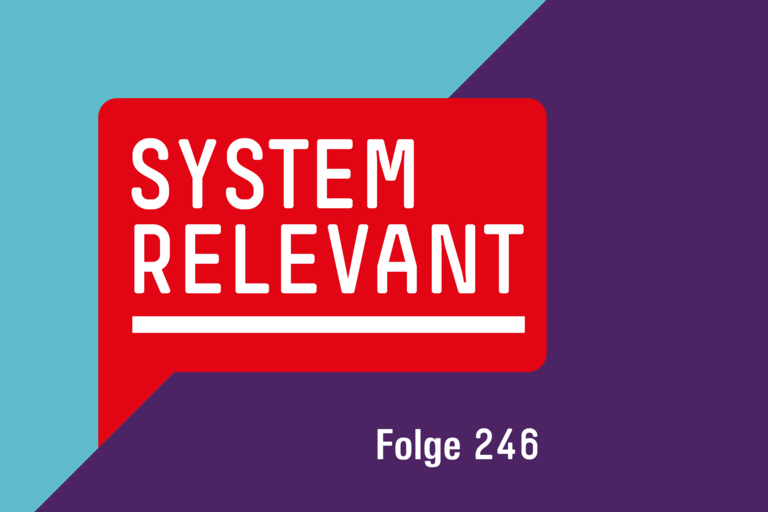Pflege: Tarifflucht darf nicht belohnt werden
Die Politik wollte für bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Tarifbindung im Pflegesektor sorgen – doch die seit 2022 geltende Neuregelung verfehlt ihr Ziel. HSI-Direktor Ernesto Klengel und die HSI-Sozialrechtlerin Sandrina Hurler erklären, was sich ändern muss.
Pflegekräfte haben einen aufreibenden Job und leisten gesellschaftlich wichtige Arbeit. Ist es da nicht absolut angemessen, Lohndumping durch eine Pflicht zur Tarifbezahlung zu verbieten?
Ernesto Klengel: Ja, denn Tarifverträge, die von durchsetzungsfähigen Gewerkschaften getragen werden, sorgen für faire Löhne und ein solidarisches Vergütungssystem. Allein im Gesundheitsbereich arbeiten fast sechs Millionen Beschäftigte. Untersuchungen zufolge ist Frust über die geringe Bezahlung weit verbreitet. Dass sich der Gesetzgeber für eine faire Bezahlung einsetzt, ist aber nicht nur aus Sicht der Pflegenden geboten, sondern auch angesichts des demografischen Wandels und der Versorgungslage dringend notwendig. In der Sache scheint diese Erkenntnis mittlerweile bei den Verantwortlichen angekommen zu sein. Mit Blick auf die Reformen muss man aber sagen: Gut gemeint ist leider nicht immer gut gemacht. Es reicht nicht, nur das richtige Ziel zu verfolgen – auch der Weg dorthin muss sinnvoll, durchdacht und praxistauglich sein. Das ist leider nicht immer der Fall, wie in dem vom HSI geförderten Projekt von Judith Brockmann und Felix Welti von der Universität Kassel deutlich wird.
Woran hapert es demnach?
Sandrina Hurler: Ich möchte mit der positiven Botschaft beginnen: Frühere Reformen haben gezeigt, dass neue Gesetze etwas bewirken können. Seit dem ersten Pflegestärkungsgesetz von 2014 muss die tarifliche Entlohnung in einer Pflegeeinrichtung durch die Pflegeversicherung in voller Höhe erstattet werden. Zuvor wurde unter Verweis auf die Wirtschaftlichkeit oftmals die Finanzierung von Tariflöhnen verwehrt – das muss man sich einmal vorstellen! Mittlerweile ist in weiten Teilen des Leistungserbringungsrechts geregelt, dass eine tariflich geregelte Vergütung als angemessen angesehen wird und der Leistungserbringer die Kosten erstattet erhält. Ein weiterer Schritt folgte im Jahr 2016. Seitdem können auch Einrichtungen ohne Tarifbindung Löhne in Tarifhöhe refinanziert bekommen. Diese Reformen scheinen dazu beigetragen zu haben, die Entlohnung im Pflegesektor zu verbessern. Die Löhne in der Altenpflege stiegen zwischen 2012 und 2019 überdurchschnittlich und in der Krankenpflege durchschnittlich.
Im Jahr 2022 wurde dann eine Pflicht zur Vergütung nach Tarif eingeführt. Auf den ersten Blick klingt das vielversprechend: Pflegeeinrichtungen erhalten nur dann eine Refinanzierung durch die Kostenträger, wenn sie einem Tarifvertrag oder einer kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinie unterliegen oder Gehälter zahlen, die im Durchschnitt dem maßgeblichen Tarifniveau entsprechen. Einrichtungen ohne Tarifbindung können sogar Gehälter refinanziert bekommen, die das regional übliche Entlohnungsniveau um bis zu zehn Prozent übersteigen. Doch genau hier zeigen sich bei näherer Betrachtung erhebliche Schwächen.
Newsletter abonnieren
Alle 14 Tage Böckler Impuls mit Analysen rund um die Themen Arbeit, Wirtschaft und Soziales im Postfach: HIER anmelden!
Weil nicht tarifgebundene Einrichtungen bessere Löhne zahlen können?
Sandrina Hurler: Genau, das verschafft ihnen Möglichkeiten, für bestimmte, besonders gesuchte Beschäftigtengruppen eine höhere Vergütung festzulegen. Es ermöglicht ihnen beispielsweise, jungen Pflegekräften deutlich attraktivere Einstiegsgehälter anzubieten. Da sie diese von den Kassen vollständig erstattet bekommen, entsteht ein Anreiz, nicht tarifgebunden zu sein. Das ist mit Blick auf die Koalitionsfreiheit nicht hinzunehmen. Außerdem kommt es zu teilweise erheblichen Gehaltsspreizungen. Beispielsweise können langjährig beschäftigte Pflegekräfte nur geringe oder gar keine Gehaltserhöhungen erhalten. Diese Rechtslage ist auch verfassungsrechtlich durchaus problematisch. Dürfen tarifgebundene Arbeitgeber hinsichtlich der Refinanzierung derart benachteiligt werden?
Eine naheliegende Lösung wäre es doch, eine Tariftreuevorschrift für die Pflege einzuführen. Dann würden sich solche Fragen erübrigen.
Ernesto Klengel: Das wäre die beste und unbürokratischste Lösung, die übrigens auch in der Diskussion war. Dagegen wurde jedoch eingewandt, dass damit die Freiheit der Unternehmen beschränkt würde, dem Tarifvertrag fernzubleiben. Darauf kann erwidert werden: Dieses Interesse muss zurückstehen, weil die Erhöhung der Tarifbindung im übergeordneten Allgemeininteresse liegt. Die Rechtsprechung sagt lediglich, dass ein rechtlicher oder tatsächlicher Zwang, dem Tarifvertrag beizutreten, unzulässig sei. Dennoch: Die Rechtsfrage, ob eine solche Ausgestaltung unzulässig wäre, ist bislang nicht geklärt. Leider wurde also – mit Blick auf die unklare Rechtslage – von einer harten Tariftreueregelung abgesehen. Dafür fehlte wohl der politische Mut.
Gibt es weitere Probleme? Wahrscheinlich ist es doch beispielsweise recht aufwendig, die korrekten ortsüblichen Löhne zu ermitteln.
Sandrina Hurler: Nicht nur die Ermittlung des Durchschnittslohns stellt eine Herausforderung dar. Durch die neuen Regelungen entstehen umfangreiche Mitteilungs-, Kontroll- und Ermittlungsverpflichtungen, die mit der vorgeschriebenen Feststellung des durchschnittlichen Entgeltniveaus verbunden sind. Auch tarifgebundene Einrichtungen sind verpflichtet, an dieser Erhebung mitzuwirken – ein weiterer Nachteil für diese Einrichtungen.
Gibt es weitere Alternativen, faire Löhne in der Pflege zu erreichen?
Sandrina Hurler: Es gibt Alternativen. Kehrte man zur Rechtslage von 2016 zurück, würde zumindest der Anreiz entfallen, die Tarifbindung zu verlassen. Ein starkes Signal für eine Stärkung der Tarifbindung wäre das aber nicht. Damit ein guter Tarifvertrag geschlossen werden kann, benötigen Gewerkschaften organisatorische Stärke. Der Pflegebereich ist aber kleinteilig strukturiert, die persönliche Ansprache ist schwierig, was gewerkschaftliche Arbeit erschwert. Die Refinanzierung durch die Kassen macht es schwer, durch Arbeitskämpfe gegenüber dem Vertragsarbeitgeber Druck aufzubauen. Für viele Beschäftigte widerspricht es zudem ihrem Berufsethos, die Arbeit niederzulegen. Langfristig stellt daher ein guter Rahmen für gewerkschaftliche Organisation im Pflegesektor einen zentralen Baustein dar, um faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen dauerhaft zu sichern. Eine weitere Möglichkeit ist die Einführung eines verbindlichen Branchenmindestlohns.
Wie sieht es mit den sonstigen Arbeitsbedingungen aus?
Ernesto Klengel: Aus Studien wissen wir: Die Arbeitszufriedenheit – und damit auch die Attraktivität des Pflegeberufs – hängt nicht allein von der Entlohnung ab. Ebenso entscheidend sind Aspekte wie Arbeitsbelastung, Personalschlüssel, Pflegequalität sowie Mitbestimmungsrechte. Wichtige weitere sogenannte nichtmonetäre Faktoren sind etwa die schlechte Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben sowie die zahlreichen Dokumentationspflichten. Gerade weil es in der Pflege an Personal mangelt, sind die Einrichtungen häufig unterbesetzt. Das führt zu einer Beanspruchung, die man nicht dauerhaft aushalten kann, und zu Überforderung. Natürlich leiden auch die Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, unter dieser Situation. Daher sind in der Vergangenheit auf verschiedenen Ebenen Personalschlüssel, also Mindestbesetzungsregelungen, eingeführt worden. Bei allen bisherigen Regelungen gibt es jedoch Probleme in der Anwendung. Einen Schritt weiter gehen Entlastungstarifverträge, die in einigen Krankenhäusern der Maximalversorgung abgeschlossen werden konnten, wenn auch nur als Ergebnis intensiver Arbeitskämpfe. Einige Rechtswissenschaftler sind der Auffassung, dass solche Tarifverträge von vornherein unzulässig seien, weil sich Regelungen zur Personalausstattung bereits in Gesetzen finden. Diese Annahme geht aber fehl. Denn die gesetzliche und die tarifvertragliche Regelung widersprechen sich nicht, sie ergänzen sich.
Ein Sammelband des HSI widmet sich ausführlich der Bezahlung, den Arbeitsbedingungen, der Personalbemessung, der Mitbestimmung und den ökonomischen Perspektiven der Kranken- und Altenpflege:
Judith Brockmann/Felix Welti (Hrsg.): Sozialrecht und Tarifbindung, Regulierung von Arbeitsbedingungen durch Leistungserbringungsrecht?, HSI-Schriftenreihe Band 55