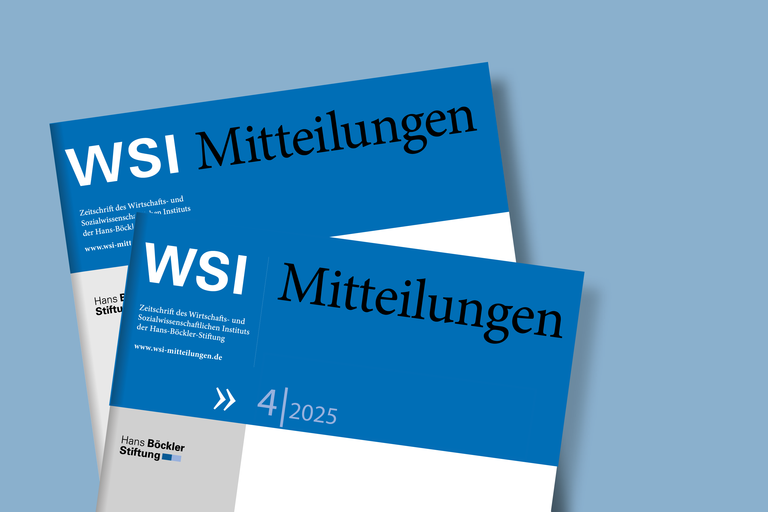Tagung „Praxis und Zukunft des Streikrechts“: Kein Streik mehr ohne promovierte Juristen?
Auf der Tagung „Praxis und Zukunft des Streikrechts“ tauschten sich Arbeitsrechtler*innen und Gewerkschafter*innen über Schadenersatzforderungen, die Zunahme juristischer Verfahren und Streiks in der kritischen Infrastruktur aus.
[23.06.2025]
Von Martin Kaluza
Arbeitskampf ist auch ein Kampf um die öffentliche Wahrnehmung. Zuverlässig schlagen die Wellen besonders dann hoch, wenn etwa die Bahn bestreikt wird. „In Deutschland wird dauernd gestreikt!“ heißt es dann oder: „Die Streiks gehen zu Lasten der Schwachen.“ In der aufgeheizten Stimmung fordern einzelne Politiker*innen von Union, FDP und AfD eine Einschränkung des Streikrechts.
Johanna Wenckebach, Justitiarin der IG Metall, ordnete diese Wahrnehmung gleich zu Beginn der Tagung zu Praxis und Zukunft des Streikrechts ein, die gemeinsam vom Hugo Sinzheimer Institut (HSI) der Hans-Böckler-Stiftung und dem DGB organisiert wurde: In Deutschland wird im europäischen Vergleich moderat gestreikt. Statistiken des WSI zeigen, dass hierzulande gerade einmal 17 Arbeitstage je 1.000 Beschäftigte durch Streiks ausfallen. Das sind etwa so viele wie in den Niederlanden, Polen und dem Vereinigten Königreich. Einsamer Spitzenreiter ist Frankreich mit 110 Tagen.
„Niemand in Deutschland streikt leichtfertig“, sagte Wenckebach, allein schon, weil hinter jedem Streik eine lange Vorarbeit aus stetiger gewerkschaftlicher Organisierung, Analysen und Befragungen, Schulungen und Rechtsgutachten stehe. Allerdings – und das zog sich als roter Faden durch die Vorträge der Veranstaltung – sieht sie mit Sorge, dass die Gewerkschaften immer häufiger in juristische Auseinandersetzungen hineingezogen werden. Wenckebach: „Je komplizierter die rechtlichen Anforderungen werden und je größer die Angriffe, umso kleiner wird das Feld, in dem sich Menschen ohne Promotion im Arbeitskampfrecht autonom bewegen können.“
Dass die Rechtsprechung komplex und nicht immer berechenbar ist, hatte bereits Andrea Baer, die Präsidentin des Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg in ihrem Grußwort zum Auftakt der Tagung beschrieben. „Das Streikrecht ist eine Erfolgsgeschichte,“ sagte Baer. Es sei prägend für die gesellschaftliche Wahrnehmung kollektiver Interessen. „Für die Arbeitsgerichtsbarkeit ist es allerdings auch eine Herausforderung. Vieles muss schnell entschieden werden, mit erheblichen Auswirkungen.“
Klagen der Arbeitgeber ziehen großen juristischen Aufwand nach sich
Bei den Gewerkschaften binden die rechtlichen Auseinandersetzungen erhebliche Ressourcen. Die Verantwortung sieht Tino Junghans, Leiter des Kompetenz-Centers Kollektives Arbeitsrecht beim DGB-Rechtsschutz, allerdings bei den Arbeitgebern. Die meisten Verfahren würden von ihnen angestoßen. Die Gewerkschaften seien fast ausschließlich als die verteidigende Seite an den Verfahren beteiligt. „Wir wollen ja gar nicht, dass sich Juristen mit Streiks befassen“, sagte Junghans. Die häufigsten Klagegründe seien kurzfristige Streikankündigungen, angebliche Verstöße gegen die Friedenspflicht und die Betroffenheit schutzbedürftiger Dritter. „Sehr häufig haben die Klagen keine Aussicht auf Erfolg“, sagte Junghans. „Das heißt, sie dienen dazu, Druck auszuüben.“
Dieser Druck bleibt nicht folgenlos, weiß Nadine Brandl, die als Leiterin des Bereichs Recht und Rechtspolitik bei Verdi viele Streiks begleitet hat. „Streikteilnahme setzt Mut der Beschäftigten voraus. Das funktioniert weniger gut, wenn wir Streiks aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung absagen müssen,“ sagte Brandl. Ihr bereitet besonders der Paragraph 62 des Arbeitsgerichtsgesetzes Kopfschmerzen, der besagt, dass Urteile vorläufig vollstreckbar sind. Die Folge: „Unterliegen wir mit hohen Schadenersatzforderungen in erster Instanz, gehen wir in Vorkasse, bis zum Bundesverfassungsgericht, in der Hoffnung, dass dort anders entschieden wird,“ sagte Brandl. Verdi habe zuletzt häufiger gestreikt und stehe nun in Gerichtsverfahren mit Haftungshöhen im Millionenbereich.
Florian Rödl, Professor für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht an der FU Berlin, teilte Brandls Beobachtung: „Wir sehen mit Sorge, dass das Risiko eines Schadenersatzes stark gestiegen ist. Es kann doch nicht sein, dass ein Handeln in demokratischen Institutionen mit solchen Haftungsrisiken einher geht!“ Das Publikum teilte die Bedenken: Wenn Streiks nur noch mit viel juristischem Beistand möglich sind, ist die Tarifautonomie in Gefahr.
Ein nur schwer nachvollziehbares Beispiel aus der Praxis stellte Grégory Garloff, Leiter der Rechtsabteilung bei der NGG, vor. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hatte im vergangenen November zu entscheiden, ob Forderungen wie Regenerationstage oder Umwandlungstage zulässige Streikziele sein können, obwohl in früheren Verhandlungen Entlastungsthemen zwar bereits angesprochen, aber dann nicht vereinbart worden waren. Der Arbeitgeber habe sich auf die Friedenspflicht berufen, eine Einstweilige Verfügung beantragt, und gesagt: Diese Themen seien zwar damals keine offiziellen Gewerkschaftsforderungen gewesen, aber letztlich mündeten die Verhandlungen in eine tarifliche Zulage. Damit sei das Thema abschließend geregelt worden. Das Gericht habe dem Arbeitgeber Recht gegeben. Daraus ergebe sich für Garloff die praktische Frage: „Genügt es, wenn ein Arbeitgeber forderungsfremde Themen in die Verhandlung einstreut und dann Friedenspflichten für die nächste Tarifrunde begründet? Darf man dann darüber als Tarifpartei nicht mehr sprechen?“ Das LAG habe mit der Entscheidung eine praxisferne Ausweitung der Friedenspflicht vorgenommen, sagte Garloff, „und das in einem Einstweiligen-Verfügung-Verfahren, in dem es ja um offensichtliche Rechtswidrigkeit gehen sollte.“
Streiken in der kritischen Infrastruktur
Besonderen Druck spüren die Gewerkschaften, wenn sie zu Streiks in Unternehmen der Daseinsvorsorge und der kritischen Infrastruktur aufrufen. Häufig werden diese Auseinandersetzungen von überwiegend konservativen Politiker*innen genutzt, um Einschränkungen des Streikrechts zu fordern. Dabei stehe das Streikrecht dem Gemeinwohl nicht entgegen. Im Gegenteil: Jens Schubert, Professor für Recht der Sozialen Arbeit an der BTU Cottbus-Senftenberg zählt es zu einem zentralen Bestandteil der Rechts- und Wirtschaftsordnung. Es sei kein Fremdkörper, der einer Rechtfertigung bedürfe. Wenn Dritte von Streikmaßnahmen betroffen seien, biete der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ausreichend Gewähr, Streikexzesse zu unterbinden, sagte Schubert.
Silke Kohlschitter, Vizepräsidentin des Arbeitsgerichts Frankfurt/Main, gab einen grundsätzlichen Überblick über den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Arbeitskampfrecht. Sie zeigte sich verwundert, dass nach der Rechtsprechung nicht staatliche Eingriffe in das Streikrecht verhältnismäßig sein müssen, sondern das Streikrecht verhältnismäßig ausgeübt werden müsse. Dies gäbe es bei keinem anderen Grundrecht. Kohlschitter fragte provokativ: „Wer käme, wenn der Künstler malt, das Orchester musiziert, wenn die Gläubige betet, auf den Gedanken zu prüfen, ob deren Tun verhältnismäßig ist?“
Doch nicht nur direkte Angriffe auf das Streikrecht gefährden die Tarifautonomie. Vorhandene Probleme können im Streik erst sichtbar werden und so für Unmut sorgen. Im Bereich der Pflege etwa komme es häufig vor, dass zwischen dem Normalbetrieb und dem Notfallplan kaum Unterschiede bestünden, weil die Betriebe im Normalbetrieb bereits viel zu knapp besetzt sind – de facto sei das eine Beschneidung des Streikrechts. Und Ghazaleh Nassibi, Leiterin der Abteilung Arbeits- und Sozialrechtspolitik der IG BAU, ergänzte: „Auch Teilzeit ist ein Faktor. In der Gebäudereinigung beispielsweise arbeiten überwiegend Frauen, und das in Teilzeit. Da ist es schwerer, einen Streik zu organisieren als in der Baubranche, in der überwiegende Männer in Vollzeit arbeiten.“
Schlussrunde mit Bundestagsabgeordneten
Für eine Schlussrunde hatten die Veranstalter vier Bundestagsabgeordnete eingeladen, die Mitglieder im Ausschuss Arbeit und Soziales sind. Stefan Nacke, Abgeordneter der CDU und stellvertretender Bundesvorstand der CDA, bekräftigte gleich zu Beginn: „Die Frage, welche Auswirkungen Streiks in der kritischen Infrastruktur auf Dritte haben, wird in der CDU diskutiert. Aber ich kann für meine Richtung innerhalb der CDU und innerhalb der Bundestagsfraktion der Arbeitnehmergruppe sagen: Wir sehen keine Veränderungsnotwendigkeit.“ Große Fortschritte für die Arbeitnehmer mochte er allerdings für die nächste Legislaturperiode nicht versprechen. Die Prioritäten der Politik lägen im Moment bei der äußeren Sicherheit. „Wir müssen sehen, dass die Situation für die Arbeitnehmenden nicht vergessen, sondern weiterentwickelt wird“, sagte Nacke.
SPD-Abgeordneter Jan Dieren erhofft sich vom Tariftreuegesetz, das noch von der Ampel auf den Weg gebracht wurde und das die neue Regierung nun umsetzen will, Strahleffekte über öffentliche Ausschreibungen hinaus. Dies könne allerdings nur ein Schritt auf dem Weg zu mehr Tarifbindung sein. Pascal Meiser, der als Kandidat für Die Linke das Direktmandat in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg holte, geht das geplante Tariftreuegesetz nicht weit genug. Er forderte beispielsweise, dass Tarifverträge auch weitergelten müssten, wenn Unternehmen ausgegliedert oder umstrukturiert werden und wies auf Lücken im Entsendegesetz hin.
Ricarda Lang von den Grünen unterstrich die Bedeutung von Streiks auch in Pflegebetrieben: „Dass es Verdi geschafft hat, in diesen Bereichen unter schweren Bedingungen so viele Leute zu organisieren, macht die Pflege attraktiver.“ Das Streikrecht sieht sie als einen besonders gut funktionierenden Mechanismus der gesellschaftlichen Willensbildung. Lang: „Wir sehen gerade in anderen politischen Feldern wie der Klimapolitik, wie schwierig es ist, wenn es keine eingeübten Mechanismen zur Konfliktbehandlung in der Gesellschaft gibt, wenn alles politisiert wird.“
Mehr Infos
- Zusammenfassung der Beiträge im HSI-Working Paper: Right to strike under Attack - legal counterstrategies