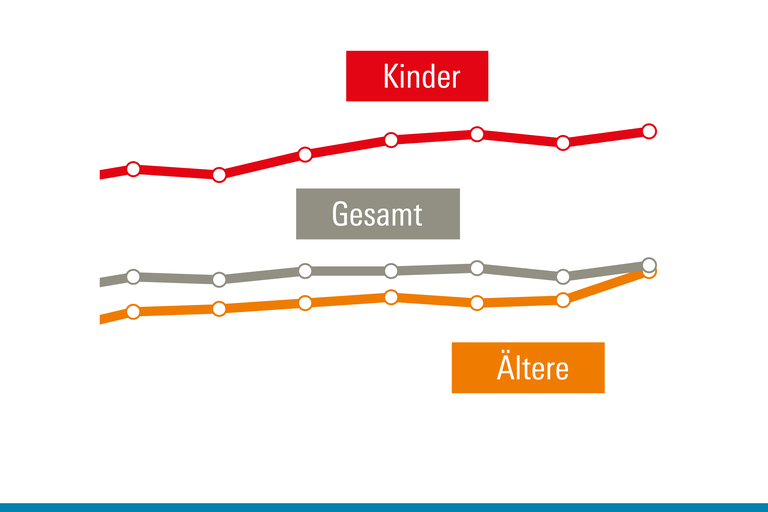Von ANDREAS KRAFT: Mindestrente - ein Ablenkungsmanöver?
Thema Eine untere Grenze kennt das Rentensystem nicht. In der Debatte um Altersarmut gibt es daher immer wieder den Vorschlag, langjährig Versicherten eine Mindestrente über dem Existenzminimum zuzusichern.
Von ANDREAS KRAFT
Viel hat sich geändert, seit Reichskanzler Otto von Bismarck im Jahr 1889 die gesetzliche Rentenversicherung einführte. Eines aber ist immer gleich geblieben: Eine Mindestrente gibt es nicht. Wem am Ende des Arbeitslebens die Rente zum Leben nicht reicht, der muss ALG II beantragen. Mit etwas Glück kann man das Haus noch behalten, das Auto ist aber ziemlich sicher weg. Kein Wunder also, dass viele den Gang zum Sozialamt scheuen – aus Angst, ihr über ein Leben aufgebautes Kleinst-Vermögen auch noch zu verlieren. Und kein Wunder, dass die Politik das Thema Mindestrente immer wieder für sich entdeckt.
Seit Jahren werden zahlreiche Konzepte unter unterschiedlichen Namen diskutiert. Ursula von der Leyen (CDU) nannte es „Zuschussrente“, bei ihrer Nachfolgerin Andrea Nahles (SPD) hieß es zunächst „solidarische Lebensleistungsrente“ und jetzt „gesetzliche Solidarrente“. 2016 traf sich Nahles mit Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften zu insgesamt drei Rentengipfeln, um zahlreiche Reformen zu diskutieren. Nach der letzten Gesprächsrunde im Spätherbst verschwand das Mindestrentenkonzept der Großen Koalition in der Schublade und wurde kurzerhand durch ein neues ersetzt. Einen entsprechenden Gesetzentwurf gibt es bis heute nicht. Dabei hatte die Regierung versprochen, bis Juli 2017 eine Mindestrente einzuführen.
Das zentrale Problem: das Rentenniveau sinkt
Beim DGB sieht man weniger die zeitlichen Verzögerungen kritisch, vielmehr sorgt man sich, die Diskussion drohe die generellen Probleme im Rentensystem zu verdecken. „Das Thema Mindestrente ist wichtig, keine Frage – aber manchmal bekommt man den Eindruck, dass Teile der Arbeitgeber und Teile der Bundesregierung das ganz gezielt immer wieder nach vorne stellen“, sagt DGB-Bundsvorstandsmitglied Annelie Buntenbach, die bei den Rentengipfeln dabei war. „Sie wollen davon ablenken, dass die Renten allgemein im Sinkflug sind. Die Arbeitgeber wollen natürlich, dass die Rentenbeiträge weiterhin niedrig gehalten werden.“
Die rot-grüne Regierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder hat 2004 der Rentenformel den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor hinzugefügt. Die Idee dahinter: Wenn immer mehr Rentner auf immer weniger Beitragszahler kommen, stößt das System irgendwann an eine Grenze und die Rentenbeiträge gehen durch die Decke. Wenn die Löhne dann nicht entsprechend steigen, bleibt den Arbeitnehmern immer weniger zum leben. Der Unmut könnte dann so groß werden, dass das ganze Rentensystem in Frage stünde. Der Nebeneffekt für die Arbeitgeber: Die Deckelung der Rentenbeiträge hält die Bruttolöhne unten und damit die Kosten für die Unternehmen. Doch die Idee hat einen entscheidenden Nachteil: Die Renten befinden sich im Sinkflug, denn mit dem Nachhaltigkeitsfaktor fällt das Rentenniveau.
Das Rentenniveau definiert, wie viel Prozent des aktuellen Durchschnittslohns der Durchschnittsrentner bekommt – eine fiktive Person, die 45 Jahre lang immer genau den Durchschnittslohn bekommen und entsprechend Beiträge gezahlt hat. Im Jahr 2005 bekam der Durchschnittsrentner noch gut 53 Prozent des Durchschnittslohns als Rente, heute sind es knapp 48 Prozent und in etwa zehn Jahren wird das Rentenniveau bei 43 Prozent liegen. Für den DGB liegt darin das zentrale Problem. Die Gewerkschaften machen sich daher seit Jahren dafür stark, das Rentenniveau stabil zu halten und im nächsten Schritt wieder anzuheben.
Die letzte Haltelinie: den Gang zum Sozialamt verhindern
Denn wenn das Niveau immer weiter sinkt, droht immer mehr Menschen – gerade in der unteren Mittelschicht – im Alter der soziale Abstieg. „Trotzdem müssen wir auch an die Menschen denken, denen jetzt schon zu wenig zum Leben bleibt“, sagt Buntenbach. „Wer jahrelang eingezahlt und wenig verdient hat, muss am Ende wenigstens so viel herausbekommen, dass er nicht zum Sozialamt muss.“ Der DGB schlägt für diese Fälle vor, besonders niedrige Entgeltpunkte um 50 Prozent aufzuwerten.
Der oben beschriebene Durchschnittsrentner bekommt für ein Beitragsjahr genau einen Entgeltpunkt. Der DGB fordert, dass niedrige Löhne so auf bis zu 0,75 Entgeltpunkte pro Beitragsjahr erhöht werden. Denn am Ende des Arbeitslebens sind die Entgeltpunkte der entscheidende Faktor, wie hoch die individuelle Rente ausfällt. Die im Laufe des Lebens gesammelten Entgeltpunkte werden addiert und dann mit dem Betrag multipliziert, den ein Punkt gerade wert ist. Aktuell sind das 30, 45 Euro im Westen und 28, 66 im Osten.
Aktuelle Statistiken legen nahe, dass die Zahl der Menschen, deren Rente zum Leben nicht reicht, stark zunehmen wird. Niemand kann die Zahlen sicher vorhersagen. Aber die Zahl der Menschen, die zwar eine Rente bekommen, aber trotzdem Grundsicherung im Alter beantragen müssen, hat sich in den vergangenen zehn Jahren nahezu verdoppelt. Im Dezember 2015 bezogen fast 415 000 Altersrentner zusätzlich Grundsicherung. Fast 60 Prozent von ihnen waren Frauen. Sie unterbrechen häufiger ihr Erwerbsleben für mehrere Jahre oder arbeiten in Teilzeit, um sich um Kinder oder pflegebedürftige Eltern zu kümmern.
Kann man von Österreich lernen?
Die Politik diskutiert daher intensiv, wie mit geringen Renten umgegangen werden soll und wie man sie auf ein vernünftiges Niveau bringen kann. „Die Frage ist dabei immer, wer genau von solchen Maßnahmen profitiert und auch profitieren soll“, sagt Florian Blank, Rentenexperte am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Eine geringe Rente aus der Rentenversicherung, so Blank, sei nämlich nicht notwendig mit Altersarmut gleichzusetzen. Schließlich könne sie durch weitere Einkommensquellen ergänzt werden – etwa der Rente des Lebenspartners, Immobilienbesitz oder einer Lebensversicherung. Man müsse deshalb die Frage stellen, ab wann die Renten wie aufgestockt werden sollen: „Wenn aus vielen Jahren vollzeitnaher Erwerbsarbeit und Beitragszahlung nur eine geringe Rente folgt, ist das auf jeden Fall ein Problem“, sagt er.
Blank rät, für einen möglichen Lösungsweg nach Österreich zu schauen. Dort wird die Rente, sofern 15 Versicherungsjahre vorliegen, mit einem Ausgleichsbetrag auf gut 890 Euro aufgestockt. Dabei werden andere Einkünfte und das Einkommen des Partners berücksichtigt, Vermögen werden allerdings nicht angerechnet. Wer zudem 30 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat, bekommt sogar einen höheren Ausgleich und kommt dann auf ein Einkommen im Alter von 1000 Euro. Zudem werden Renten in Österreich nicht nur zwölfmal, sondern vierzehnmal im Jahr ausgezahlt.
Interessant am österreichischen Rentensystem ist aber nicht nur die Absicherung nach unten, sondern auch das höhere Rentenniveau. Im Jahr 2013 kamen männliche Neu-Rentner mit langen Erwerbskarrieren in Deutschland im Durchschnitt auf eine Rente von 1050 Euro, in Österreich waren es 1560 – bei 14 Auszahlungen im Jahr. Vor gut 15 Jahren hat Österreich bei der Reform des Rentensystems einen anderen Weg eingeschlagen als Deutschland. „Ein Richtungswechsel in der deutschen Rentenpolitik wäre wünschenswert“, sagt Blank. „Das würde vielen Rentnern zugutekommen und wäre ein Baustein auch in der Absicherung gegen Altersarmut.“
Die höheren Renten in Österreich werden mit höheren Beiträgen bezahlt. Während bei uns die Rentenbeiträge derzeit bei 18,7 Prozent liegen, sind es in Österreich seit den 1980er Jahren 22,8 Prozent. Dafür werden die Österreicher aber nicht in die private Altersvorsorge gedrängt.
Fotos: Caro Fotoagentur/Andreas Bastian; Bernd von Jutrczenka/dpa
WEITERE ARTIKEL
Das Sparkonto der Kleinrentner
WEITERE INFORMATIONEN
Die Geschichte der Mindestrenten-Modelle – und der aktuelle DGB-Vorschlag
Zuschussrente (CDU/FDP-Koalition, 2009-2013)
Im Jahr 2012 schlug die damalige Arbeits- und Sozialministerin Ursula von der Leyen (CDU) die Zuschussrente vor: Im Kern sollten die Beitragszeiten höher bewertet werden. Die Ansprüche derjenigen, die sich um Kinder oder Angehörige gekümmert haben, werden um 150 Prozent aufgewertet; die Ansprüche der übrigen um 50 Prozent. Nach oben soll es aber einen Deckel bei 30 Entgeltpunkten geben.
Voraussetzung für die Zuschussrente sind zunächst 40 Versicherungsjahre (dazu zählen auch Schule und Studium) und 30 Beitragsjahre. Zudem müssen die Empfänger bedürftig sein. Daher wird die Zuschussrente so begrenzt, dass Verheiratete maximal auf ein Haushaltseinkommen von 1700 Euro kommen. Einkommen aus privater Altersvorsorge werden dabei nicht angerechnet. Ab 2019 soll eine private Altersvorsorge eine Bedingung für den Erhalt der Zuschussrente sein. 2013 hätten von der Zuschussrente 25 000 Rentner profitiert. Die Zahl der Empfänger würde aber laut den Berechnungen des Ministeriums bis 2030 auf 1,4 Millionen steigen.
Das Konzept fand in der Koalition keine Zustimmung. Die FDP störte sich vor allem daran, dass die Zuschussrente aus den laufenden Beiträgen der Versicherten finanziert werden sollte. Aber auch einer Steuerfinanzierung stand die Partei kritisch gegenüber. Gegenwind kam auch aus Teilen der Union.
Solidarische Lebensleistungsrente (Große Koalition, ab 2013)
Im Koalitionsvertrag der großen Koalition einigten sich SPD und Union darauf eine überarbeitete Version der Zuschussrente auf den Weg zu bringen. Im Lauf der Diskussion wurde die Idee konkretisiert: Die Rente wird auf 30 Entgeltpunkte aufgestockt. Voraussetzung sind aber zunächst 35 Beitragsjahre ab 2024 dann 40 Beitragsjahre. Zudem müssen die Rentner privat vorgesorgt haben. Nach Berechnungen der Bundesregierung hätte die Rente 2014 im Westen bei 760 Euro und im Osten bei 700 Euro gelegen. Finanziert wird sie über einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt an die Rentenkasse.
Vor allem bei jungen Unionspolitikern wurde Kritik laut: Die Lebensleistungsrente würde nicht den Richtigen helfen. Es würden auch Versicherte besser gestellt, die aufgrund ihres hohen Haushaltseinkommens gar nicht bedürftig seien. Gerade an den wirklich Bedürftigen ginge sie vorbei, weil die meist gar nicht so viele Beitragsjahre zusammenbekommen würden. Als Alternative schlagen sie vor, die Grundsicherung im Alter zu „entstigmatisieren“. Inzwischen ist das Konzept, das eigentlich ab Juni 2017 gelten sollte, vom Tisch.
Gesetzliche Solidarrente (Bundesministerium für Arbeit und Soziales/SPD, 2017)
Zu niedrige Renten werden so aufgestockt, dass sie zehn Prozent über dem regionalen Existenzminimum liegen. In den Genuss der Solidarrente kommt aber nur, wer 35 und ab 2023 40 Jahre Beiträge gezahlt hat: Dabei sollen Auszeiten für Kinder, Pflegebedürftige oder wegen Arbeitslosigkeit angerechnet werden.
Der Reiz des Modells liegt darin, dass der Gang zum Sozialamt entfällt. Zudem werden die Ehepartner weniger in die Pflicht genommen, es kann mehr Vermögen behalten werden und die Rentner müssen weniger offenlegen als die Bezieher von Grundsicherung. Vor allem in Regionen in denen die Lebenshaltungskosten besonders hoch sind, könnten von der Regelung relativ viele Rentner profitieren. Aufgrund hoher Mieten liegt in München das Existenzminimum derzeit etwa bei 1100 Euro. Erzieherinnen, Köche, Gebäudereiniger oder Verkäufer erzielen auch nach 40 Beitragsjahren in Vollzeit nicht eine derart hohe Rente.
Rente nach Mindestentgeltpunkten (DGB, 2017)
Niedrige Löhne werden rententechnisch um bis zu 50 Prozent besser gestellt als bisher. Für ein Beitragsjahr gibt es dann bis zu 0,75 Entgeltpunkte. Voraussetzung ist, dass 35 Jahre rentenrechtlich anrechenbar sind, was Zeiten von Arbeitslosigkeit oder Kindererziehung einschließt. Im Westen entspräche dies aktuell nach 40 Jahren einer Rente von gut 810 Euro, die Sozialabgaben schon abgezogen. Eine Bedürftigkeitsprüfung gäbe es nicht. Aber einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt an die Rentenkasse.
Dafür würden von der Regelung relativ viele Rentner profitieren. Denn auch die Rente derjenigen würde steigen, die nur für manche Beitragsjahre sehr wenige Entgeltpunkte auf ihrem Rentenkonto verbuchen konnten – etwa weil sie einige Jahre Teilzeit gearbeitet haben, um Kinder oder Angehörige zu betreuen. Zudem ist für das Modell keine große Reform nötig. Denn für Beschäftigungszeiten vor 1992 gilt diese Regelung bereits. Man müsste die bestehenden Regelungen also nur auf die Zeit nach 1992 ausweiten.