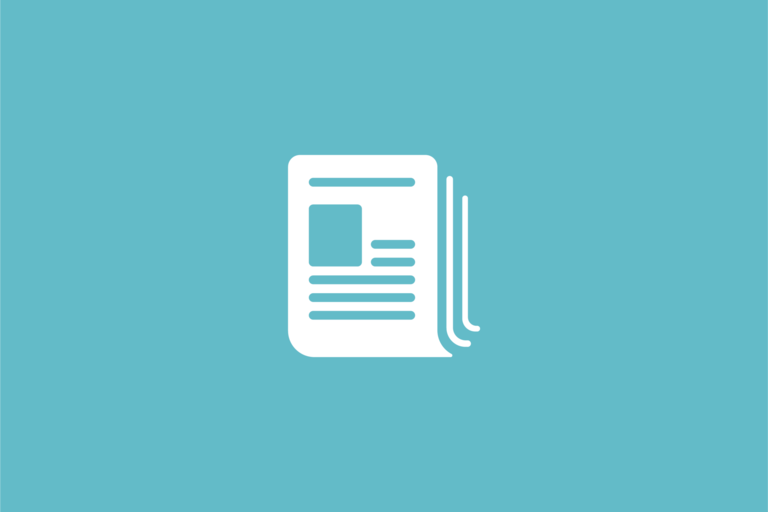: Das Geschäft mit der Bildung
PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP Angesichts leerer Kassen verlassen sich Länder und Kommunen bei Investitionen in Schulen und Bildungszentren auf private Geldgeber. Von Ingmar Höhmann
Ingmar Höhmann ist Wirtschaftsjournalist in Köln./Foto: Rainer F. Streussloff/intro
Im Bildungszentrum Ostend lassen sich Frankfurter Politiker gerne sehen - es ist ein Vorzeigeobjekt der Mainstadt. Der vor fünf Jahren fertiggestellte Gebäudekomplex beherbergt die Volkshochschule, zwei Abendgymnasien, eine Berufsschule, eine Bankakademie und eine Musikschule. Nur 20 Monate dauerte die Bauzeit, bei einem Projekt dieser Größenordnung eine eindrucksvolle Leistung. Vollbracht hat diese nicht die öffentliche Hand, sondern ein privates Konsortium: Das Bildungszentrum ist ein sogenanntes Public-Private-Partnership-(PPP)-Projekt. Dabei übernehmen private Akteure sowohl die Planung, die Finanzierung, den Bau als auch den Betrieb eines öffentlichen Gebäudes.
Die Stadt Frankfurt mietet ihr neues Bildungszentrum nun für den Zeitraum von 20 Jahren zurück. Danach geht es in öffentlichen Besitz über - so sieht es der PPP-Vertrag vor. Eigentlich könnte sich Frank Heudorf, zuständiger Bereichsleiter der Kämmerei Frankfurt, freuen. Das erste große Hochbauprojekt dieser Art in Deutschland ist auch sein Werk. Der Bundesverband PPP hat ihm sogar eine Auszeichnung verliehen - Heudorf ist der "PPP-Mann 2008". Doch Privatisierungsgegner lassen ihm keine Ruhe. Immer wieder bekommt er die Frage gestellt: Warum betreibt die Stadt das Bildungszentrum nicht selbst? Heudorf winkt ab. "Alles, was nach Privatisierung riecht, wird ideologisch angegriffen", sagt er. Dabei wäre alles in Eigenregie zu machen viel teurer geworden. Das PPP-Modell habe der Stadt eine Einsparung von 21 Prozent beschert, sagt Heudorf.
Gewerkschaften und Globalisierungsgegner zweifeln diese Rechnung an. Sie stützen sich auf einen Bericht der Innenrevision. Demnach hat es Frankfurt fast zehn Prozent mehr gekostet, den Auftrag an den Finanzdienstleister Süd-Leasing zu vergeben und das Zentrum vom Stuttgarter Unternehmen Müller-Altvatter (heute BAM) bauen und betreiben zu lassen. Das Bildungszentrum Ostend sollte die Zusammenarbeit von Staat und Privatwirtschaft in eine neue Dimension hieven. Doch viele sehen in dem 50 Millionen Euro teuren PPP-Projekt ein Symbol für den fortschreitenden Rückzug des Staates aus dem Bildungssektor. Immer häufiger lassen Städte öffentliche Gebäude von Unternehmen bauen und verwalten. Gleichzeitig explodiert die Zahl der privaten Schulen und Hochschulen. Zunehmend mischen Firmen und unternehmensnahe Stiftungen über gesponserte Lehrstühle auch bei den Inhalten mit. Ist die staatliche Bildungshoheit in Gefahr?
Klar ist: Die schwierige Finanzlage zwingt die Kommunen zur Partnersuche. Das Deutsche Institut für Urbanistik summiert den Investitionsbedarf für die deutschen Städte bis 2020 auf gigantische 700 Milliarden Euro. PPP bietet einen Ausweg: Rund ein Viertel der Kommunen und Länder wollen in den nächsten fünf Jahren solche Vorhaben anstoßen. Insgesamt plant die öffentliche Hand Projekte mit einem Volumen von 14,2 Milliarden Euro.
DIE NEUEN SCHULBETREIBER_ Bröckelnder Putz, undichte Dächer und wackelige Tische - massiv leiden Bildungseinrichtungen unter dem Geldmangel. An vielen Schulen gehört Sparen an Material und Personal zum Alltag. Weite Teile der Bevölkerung hätten das Vertrauen in das Schulsystem verloren, sagt Reinhold Jäger, Leiter des Zentrums für empirische pädagogische Forschung der Uni Koblenz-Landau. Umfragen zufolge glaubt jeder zweite Deutsche, dass der Staat mit der Qualitätssicherung im Schulwesen überfordert ist. "Das Geld fehlt an allen Ecken und Kanten", sagt Jäger. "Wir kommen um die Unterstützung durch private Initiativen nicht mehr herum."
Unternehmer hoffen auf das große Geschäft: Ob in Hamburg oder Köln, Offenbach oder Velbert - überall in Deutschland bauen, sanieren und verwalten private Firmen inzwischen staatliche Schulen. Sie stellen Hausmeister, Köche und Putzkolonnen ein, nur beim Lehrpersonal entscheiden die Behörden. Am eifrigsten ist Hochtief Concessions: Das Konzessions- und Betreiberunternehmen betreibt in Deutschland, Großbritannien und Irland 104 Schulen mit mehr als 70 000 Schülern.
Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie hat für seine Mitglieder einen Leitfaden erstellt, der Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen soll. Das wichtigste Argument ist Effizienz: Ein Unternehmen minimiere die Kosten langfristig, so die Industrievertreter, denn der Einkauf sei billiger, der Personaleinsatz durchdachter und der Verwaltungsaufwand geringer. Die durchschnittliche Einsparung der 134 bisherigen PPP-Hochbauprojekte liege gegenüber einer konventionellen Beschaffung bei 14,5 Prozent, behauptet die Bauindustrie.
Manche Wissenschaftler sprechen von schöngerechneten Zahlen. "Die Effizienzgewinne werden erheblich überschätzt", sagt Holger Mühlenkamp, Professor für öffentliche Betriebswirtschaftslehre in Speyer. PPPs haben auch gravierende Nachteile: Ein Unternehmen muss bei Krediten höhere Zinsen zahlen als der Staat, zudem fallen zusätzliche Kosten an - etwa durch Ausschreibung, Nachverhandlungen und Kontrolle der Betreiber während der Vertragslaufzeit.
Doch niemand kann verlässlich voraussagen, wie Kreditzinsen und Verwaltungskosten sich über die teils mehrere Jahrzehnte laufenden Verträge entwickeln. Wer beurteilen will, ob sich ein PPP-Projekt rechnet, kommt um Schätzungen nicht herum - das öffnet Manipulationen Tür und Tor. Ein Grund ist die unvollständige Datenlage, die Vergleiche erschwert. "Kein Mensch kann heute sagen, was Kommunen in Deutschland im Schnitt pro Schüler ausgeben", sagt der Weimarer Betriebswirtschaftler Wilhelm Alfen.
EKLATANTE MÄNGEL_ Klar positioniert hat sich die Welt-Erziehungsgewerkschaft Education International. Sie kommt in einer von der Hans-Böckler-Stiftung unterstützten Studie zu PPPs zu dem Ergebnis: "Es gibt keinen Beweis dafür, dass PPPs für Bildungsinfrastrukur den öffentlichen Haushalten langfristig Einsparungen bringen. Ebenso wenig bieten sie mehr Effizienz, Innovation oder Disziplin", schreiben die Autoren. "Die angeblichen Vorteile, mit denen die Befürworter argumentieren, lassen sich nicht beweisen."
Mancherorts entstehen sogar neue Probleme mit der PPP-Branche. Eltern und Schüler berichten von schlechtem Service und neuer Bürokratie. In einer Frankfurter Schule war der von den privaten Betreibern angestellte Hausmeister nur per Telefon-Hotline zu erreichen. Nachmittags verriegelten die Angestellten das Gelände - und verscheuchten Schüler, die sich dort zum Spielen getroffen hatten. Auch beim Bildungszentrum Ostend gab es eklatante Mängel: Fluchtwege fehlten, die Klassenräume waren zu klein, die versprochene Cafeteria ließ jahrelang auf sich warten. "Ein privater Betreiber sucht überall nach Einsparmöglichkeiten", sagt Karsten Schneider, Referatsleiter bei der Hans-Böckler-Stiftung. "Die Theater-AG kann dann nachmittags nicht mehr proben, weil das der PPP-Vertrag nicht vorsieht. Hinterher muss die Stadt einspringen, um die zusätzliche Raumnutzung zu zahlen."
Weil auch den Kommunen die Nachteile bekannt sind, vermuten Privatisierungsgegner hinter dem Beharren auf PPP ein anderes Motiv als bloße Effizienzsteigerung: Die Städte bemühten sich um Investoren, weil sie aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen keine neuen Schulden mehr machen dürften. Wie Politiker dank PPP trotz leerer Kassen investieren können, zeigt das Medienhaus in Mülheim an der Ruhr. Die Stadt hat das 41 Millionen Euro teure Gebäude, in dem eine Bibliothek samt Kino und Café untergebracht sind, im August 2009 eröffnet. Bau, Finanzierung und Betrieb hat der private Partner SKE Facility Management übernommen. Die Stadt hätte sich das nicht leisten können, weil die Kommunalaufsicht die Neuverschuldung nicht genehmigt hätte. Die Raten aber, die die nächsten 25 Jahre an den Investor fließen, tauchen im Haushalt nicht auf. Mülheim konnte so die Kosten in die Zukunft verlagern. "Einige Städte nutzen PPP offenbar, um Schuldengrenzen zu unterlaufen", sagt Forscher Mühlenkamp. "Doch beweisen lässt sich das nicht."
ÖFFENTLICHES GELD FÜR DIE PRIVATEN_ Gute Geschäfte dagegen machen Unternehmen, die den Bildungssektor als Zukunftsmarkt entdeckt haben. Die Ernst Klett Gruppe, mittlerweile ein europäischer Bildungskonzern, baut gezielt ihr Fortbildungs-Portfolio aus: Bei berufsbegleitenden Masterstudiengängen zum Beispiel wird in den nächsten Jahren eine Verzehnfachung der Nachfrage erwartet. Ein lukratives Geschäft: Ein zweijähriger Masterstudiengang schlägt mit 15.000 Euro Studiengebühren zu Buche.
Länder und Kommunen stärken die privaten Initiativen - selbst wenn das zulasten ihrer eigenen Angebote geht. Dieses Phänomen ist derzeit bei Hessens Universitäten zu beobachten: Während die öffentlichen Hochschulen 30 Millionen Euro einsparen müssen, bekommt die private European Business School in Oestrich-Winkel 24,7 Millionen Euro vom Land dazu, damit sie in Wiesbaden eine Juristenausbildung starten kann. Die Stadt unterstützt das Projekt zusätzlich mit zehn Millionen Euro. Auf finanzielle Hilfe kann auch die Privatuniversität in Witten-Herdecke in NRW zählen: Immer wieder musste der Staat Gelder nachschießen, weil sich der Betrieb nicht aus Studiengebühren und Drittmitteln finanzieren ließ. Dagegen musste die "International University" in Bruchsal trotz der Millionen von Land und Kommune schließen.
Private und staatliche Akteure arbeiteten oft schlecht zusammen, sagt Wilfried Lohre. Er leitet in Bonn das Bundesprogramm "Lernen vor Ort", das 60 Millionen Euro bereitstellt, damit Gemeinden ihr Bildungsmanagement professionalisieren. "Die Stiftungen bieten Hochbegabtenförderung in solchen Städten an, die ein dringendes Migrationsproblem angehen müssten. Wir wollen, dass die Stiftungen mit den Kommunen reden, damit sie die wirklichen Probleme erkennen."
So wie in Lübeck. In der Hansestadt will die Possehl-Stiftung mit 1,4 Millionen Euro vier Kunstrasen-Plätze finanzieren. Weil ihr der Überblick über den Bedarf fehlt, hat sie die Stadt aufgefordert, eine Prioritätenliste zu erstellen. Kultursenatorin Annette Borns sieht die Kooperation als zukunftsweisend an: "So können wir ein stadtweites Konzept entwickeln, damit die Sportplätze dort entstehen, wo sie am dringendsten gebraucht werden." Als Vorbild gilt auch der mit zwei Millionen Euro ausgestattete Lübecker Bildungsfonds, der Schüler aus hilfsbedürftigen Familien unterstützt. Er speist sich aus öffentlichen und privaten Mitteln. Kultursenatorin Borns sagt, ihr sei es egal, woher das Geld stamme. Sie beklagt, dass "die Volksvertreter die Bildung offenbar immer seltener auf der Liste haben. Daher springen jetzt bei Einzelprojekten die Bürger mit Spenden ein."
Mehr Informationen
Studie der globalen Gewerkschaft Education International zum Thema "Public Private Partnerships in Education" (Koordinator Guntar Catlaks), September 2009, 187 Seiten (auf Englisch) hier zum Download (pdf)
Eine kurze Infobox zur oben genannten Studie auf Deutsch hier als pdf