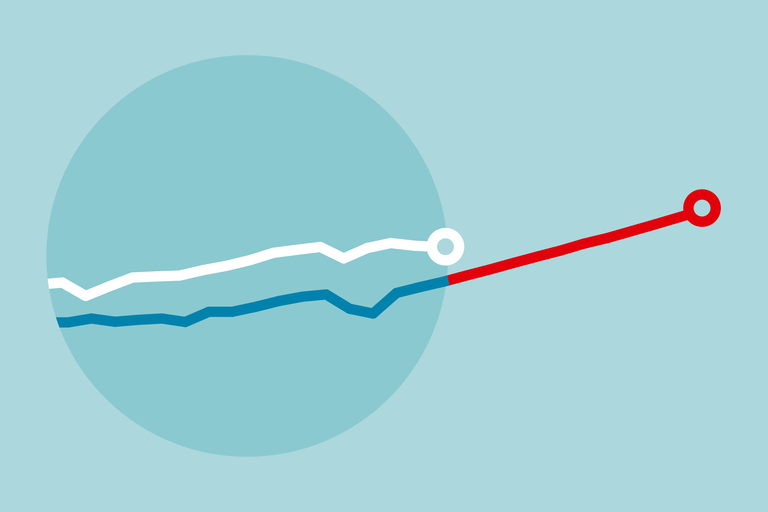Sozialpolitik: Neue Rechte mit alten Scheinlösungen
Am rechten Rand gibt es Versuche, linke Denkansätze zu vereinnahmen, um der eigenen Programmatik einen sozialen Anstrich zu geben. Der Kern der völkischen Ideologie bleibt davon unberührt.
Bisweilen werden seltsame Hybride in der rechten Szene ausgebrütet: Schriften wie „Marx von rechts“, deren Verfasser vorgeben, weltanschauliche Gegensätze zusammenzudenken. Was es damit auf sich hat, haben Matheus Hagedorny von der Universität Potsdam, Felix Schilk von der Universität Tübingen und Johannes Kiess von der Universität Leipzig anhand der Texte von zwei prominenten Aktivisten untersucht. Ihrer von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Studie zufolge steckt hinter dem Interesse an linken Theorien keine wirkliche ideologische Öffnung, sondern eher ein taktisches Manöver: Versatzstücke linker Autorinnen und Autoren würden adaptiert und umgedeutet, um das gegnerische politische Lager zu provozieren, die eigene Angriffsfläche zu verringern und den Eindruck zu erwecken, sich um die soziale Frage zu kümmern. Soweit eine soziale Doktrin der Neuen Rechten erkennbar ist, gehe es nicht um Gleichheit für alle, sondern um Unterordnung und „exkludierende Solidarität“, die sich auf Deutsche im Sinne völkischer Ideologie beschränkt.
Newsletter abonnieren
Alle 14 Tage Böckler Impuls mit Analysen rund um die Themen Arbeit, Wirtschaft und Soziales im Postfach: HIER anmelden!
„Das Bizarre an der rechtspopulistischen Rezeption von linken Theorie-Klassikern ist die Fixierung, in der sie stets mündet“, sagt Christina Schildmann, Leiterin der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung: „Egal, ob die Vordenker der Neuen Rechten Karl Marx lesen, Rosa Luxemburg oder Antonio Gramsci: Statt einen Konflikt zwischen Arbeit und Kapital sehen sie immer nur die angebliche Bedrohung durch Migration und ‚globale Eliten‘.“
Die besagte „Neue Rechte“ stelle eine Eigenbezeichnung in Abgrenzung zur stärker parteipolitisch geprägten „alten Rechten“ dar, schreiben Hagedorny, Schilk und Kiess. Die Aktivitäten dieser Szene, deren Dunstkreis von Publikationen wie der „Jungen Freiheit“ über Denkfabriken wie dem mittlerweile aufgelösten „Institut für Staatspolitik“ bis hin zur AfD reicht, stünden im Zeichen einer „metapolitischen Hegemoniestrategie“. Ziel sei es, im vorpolitischen Raum – in Bildungsinstitutionen, Militär, Kulturbetrieb, Wissenschaft, Medien und Zivilgesellschaft – eine „Kulturrevolution von rechts“ zu bewirken und so die Saat zu legen für einen autoritären Umbau von Staat und Gesellschaft.
Feindbilder sind Individualisierung und Einwanderung
Als einen wichtigen Protagonisten dieser metapolitischen Grundlagenarbeit haben die Forscher Benedikt Kaiser identifiziert, einen studierten Politikwissenschaftler, der im Umfeld der Chemnitzer Neonazi-Szene politisch sozialisiert worden ist und mittlerweile für den AfD-Bundestagsabgeordneten Jürgen Pohl arbeitet. An seinen Schriften lasse sich exemplarisch zeigen, wie rechte Ideologieproduktion konkret aussieht. Kaiser geht es nach eigenen Angaben um die „Integration adaptionsfähiger Gedanken des politischen Gegners in das eigene Weltbild“ – ohne dabei Grundannahmen des rechten Denkens infrage zu stellen. Anknüpfungspunkte für eine soziale Doktrin sieht er unter anderem beim Linkspopulismus, aber auch bei Karl Marx selbst.
Der Studie zufolge kritisiert Kaiser am Kapitalismus nicht Herrschaft oder Ausbeutung, sondern Vereinzelung und Individualisierung. Als Gegenprogramm empfehle Kaiser „solidarischen Patriotismus“. Dabei hänge die soziale Frage für ihn unmittelbar mit der „deutschen Frage“ zusammen: „Masseneinwanderung“ und Sozialstaat seien auf Dauer unvereinbar, die Neue Rechte müsse auf eine ethnisch homogene Gemeinschaft hinarbeiten.
Als zweiter wichtiger Autor taucht in der Studie Felix Menzel auf, Pressesprecher der sächsischen AfD-Landtagsfraktion, der 2018 mit „Recherche D“ das laut Eigenaussage erste Magazin der Neuen Rechten ins Leben gerufen hat, das sich ausschließlich auf ökonomische Themen konzentriert. Menzel, so die Wissenschaftler, konstruiere einen Gegensatz zwischen „nachbarschaftlicher Marktwirtschaft“ und „Globalkapitalismus“. Als dessen Hauptproblem betrachte er den „Verfall“ traditioneller Lebensformen, zu denen unter anderem die unbezahlte Arbeit der Frauen im Haushalt gehört.
Menzels eigene programmatische Vorstellungen bestehen der Analyse zufolge „im Wesentlichen aus einer Mischung aus ordoliberalen Versatzstücken und einer völkischen Mittelstandsideologie“. Die Bürgergeld-Debatte werde instrumentalisiert, um gegen Migration zu polemisieren. Gegen Altersarmut und Probleme des demografischen Wandels solle die Aufwertung vormoderner Formen der sozialen Absicherung helfen, die auf die Formel „Sozial ist Familie“ heruntergebrochen werden. Diese gingen primär zu Lasten von Frauen. Die Metapher der Familie lasse sich aber auch auf das Verhältnis von Deutschen und Zugewanderten übertragen: „Zur Familie unserer Nation kann nicht jeder gehören. Der Sozialstaat ist daher mit offenen Grenzen unvereinbar.“
Sowohl „solidarischer Patriotismus“ als auch „nachbarschaftliche Marktwirtschaft“ seien Scheinlösungen, die auf eine „De-Globalisierung unter völkisch-rassistischen Vorzeichen“ hinauslaufen, schreiben Hagedorny, Schilk und Kiess. Darauf sollten auch die Gewerkschaften regelmäßig hinweisen – indem sie „mit konkreten Beispielen daran erinnern, dass die AfD und ihr politisches Vorfeld auf die massive Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen für die meisten Menschen hinarbeiten“. Zugleich sei es angebracht, „die Erfolge einer inklusiven Solidarität selbstbewusst“ herauszustellen.
Matheus Hagedorny, Felix Schilk, Johannes Kiess: Die sozialpolitische Doktrin der Neuen Rechten – Strategische Vereinnahmung und kalkulierte Provokation, Working Paper der HBS-Forschungsförderung Nr. 362, Januar 2025