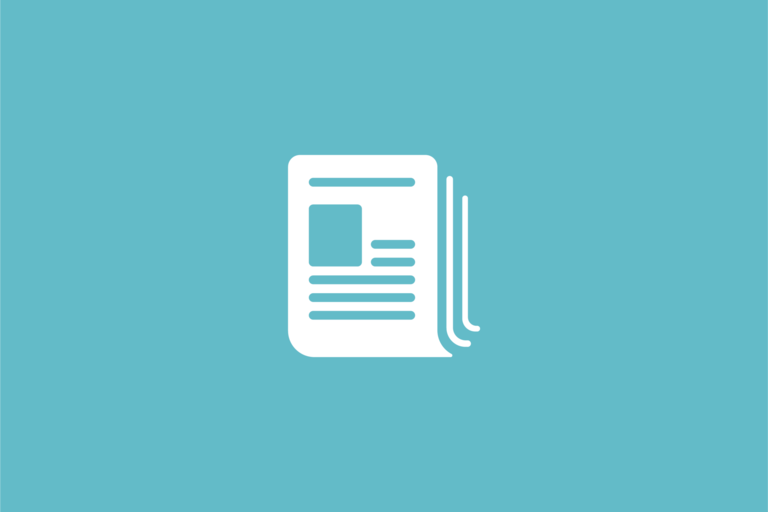: Wachsende Bildungsarmut
Durch das deutsche Bildungs- und Ausbildungssystem verfestigt sich eine neue Unterschicht. Internationale Vergleichsstudien belegen: Die deutsche Schule integriert Kinder unterschiedlicher sozialer Milieus nicht, sie sondert sie aus.
Von Jutta Roitsch
Die Autorin leitete bis 2001 das Ressort Bildung und die Doku-Seite der Frankfurter Rundschau. Sie arbeitet als Publizistin und ist im Vorstand der Gustav-Heinemann-Initiative für Menschenrechte und Frieden engagiert.
Wenn es so etwas gibt wie nationale Gewissheiten, so gehört in Deutschland der Glaube an zwei Institutionen dazu: an das Gymnasium und an die betriebliche Lehrlingsausbildung. Die beiden aufstrebenden Klassen des 19. Jahrhunderts, das städtische Bürgertum einerseits und die industrielle Arbeiterschaft andererseits, schufen sich mit und in diesen getrennten Bildungs- und Ausbildungswegen ihren jeweiligen Zugang zu Gesellschaft, Aufstieg und Anerkennung. Die eine Klasse setzte auf den unübersetzbaren Begriff Bildung, die andere auf frühzeitige Integration in das Erwerbsleben.
Beide Institutionen haben das 20. Jahrhundert überstanden, zwei Weltkriege, den Nationalsozialismus, die vielfältigen Strukturbrüche in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ideologisch und emotional von allen politischen Lagern hoch besetzt blieben Gymnasium und Lehrlingsausbildung vor jenen seit den 60er Jahren forcierten Bemühungen geschützt, für alle Jugendlichen, die in der Bundesrepublik Deutschland leben und aufwachsen, ein ganzheitliches, demokratisches Bildungs- und Ausbildungssystem zu entwickeln: ein System, welches das Grundrecht auf Chancengleichheit einlöst, das über Lebens- und Berufswege von Jungen und Mädchen nicht bereits im Kindergarten oder in der Grundschule nach der sozialen Herkunft entscheidet und das schließlich die (Klassen-)Trennung von Bildung und Ausbildung überwindet.
Dem ständigen Mahner, dem Deutschen Bildungsrat, entzog die konservative Mehrheit in den Ländern vor dreißig Jahren das Mandat und sorgte dafür, dass die nach wie vor aktuellen und weit reichenden Reformempfehlungen in Archiven verstaubte. An internationalen Vergleichstests beteiligte sich Deutschland 25 Jahre nicht. In der satten nationalen Gewissheit von der Überlegenheit des gegliederten Schulsystems mit dem Gymnasium an der Spitze und dem dualen System der Berufsausbildung meinte die große Mehrheit der Deutschen, nichts lernen zu müssen, weder von den europäischen Nachbarn noch von den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt.
Der Traum immerwährender Sicherheiten ging spätestens Mitte der 90er Jahre zu Ende, nicht zuletzt durch die deutsche Vereinigung. Zwar etablierten die oberen Schichten, die es in der politisch-ökonomischen Klasse durchaus auch in der DDR-Gesellschaft gab, schnell und aufwändig das Gymnasium als die angemessene Schulform für ihre Kinder und öffneten weit den Zugang zu den Hochschulen. Doch gelang es in den neuen Bundesländern nicht, das betriebliche Ausbildungssystem wirksam zu verankern.
Seit über einem Jahrzehnt kauft der Staat im Osten Lehrstellen. Er bildet außerhalb der Unternehmen in Berufs- oder Kompetenzzentren aus, subventioniert und prämiert kräftig den Wechsel auf eine Lehrstelle in Westdeutschland, stempelt schließlich Jahr für Jahr Tausende von Jugendlichen zu "Lernbehinderten und Benachteiligten", um sie in zahllosen Maßnahmen der Arbeitsverwaltung unterbringen zu können.
Und das alles, um grundsätzliche bildungspolitische Strukturprobleme nicht anzugehen und die Gewissheit von der Überlegenheit aufrecht zu erhalten, mit der das gegliederte Schulsystem seine Schülerinnen und Schüler in die gesellschaftliche Ordnung einweist: die Gymnasiasten in die Hochschule, die übrigen in das duale System der Berufsausbildung. Die Selbsttäuschung kostete Milliarden, welche die ostdeutschen Unternehmen oder die aus dem Boden gestampften Bildungsträger bereitwillig einsteckten. Eine langfristige Wirkung ist ausgeblieben. Auf die langfristigen Folgen für die Jugendlichen wird zurückzukommen sein.
Die eigentliche Zerstörung der Illusionen beginnt in Deutschland erst mit dem Jahr 2000 und verbindet sich mit den berüchtigt-bekannten Kürzeln wie Pisa und Hartz. Die (Wieder-)Teilnahme Deutschlands an internationalen Schulleistungstests der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) entzauberte endgültig die gepflegten Gewissheiten. Nicht nur belegten die Studien eindrücklich die mittelmäßigen Kenntnisse und Kompetenzen der deutschen Gymnasiasten, von denen der Hauptschüler ganz zu schweigen. Sie widerlegten vielmehr jene ideologischen Beschwörungsformeln über die Chancengleichheit, die Begabungs- und damit letztlich auch die Zuweisungsgerechtigkeit des deutschen Schulwesens.
Was können wir aus all den Testlawinen wissen, die mit neckisch-harmlos klingenden Namen - Pisa, Iglu, Markus oder Quasum - seit Ende der 90er Jahre über die deutschen Schülerinnen und Schüler hinwegrollen? Das deutsche Bildungssystem ist im internationalen Vergleich dasjenige System, das die Kinder und Jugendlichen am stärksten nach der sozialen Herkunft und der ökonomischen Lage der Familie selektiert. Und zwar nicht erst am Ende der allgemeinen Schulpflicht, sondern bereits im Kindergarten und in der Grundschule.
Der Blick über den nationalen Tellerrand zeigt auch: Nicht nur Deutschland kennt das Problem der sozialen Integration vor allem der Ungelernten, der Arbeitslosen und der Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Die gesellschaftliche Abschottung und Spaltung, französische Soziologen sprechen von Segregation und einer neuen Gettoisierung vor allem in den Großstädten und Ballungsgebieten, trifft in Westeuropa mehr oder weniger stark alle Länder mit harten ökonomischen Strukturbrüchen in den alten Industriezweigen des 19. und 20. Jahrhunderts und hoher Einwanderung.
Die Folgen spüren überall am schärfsten die Kinder und Jugendlichen: In Frankreich die aus den ehemaligen arabisch-afrikanischen Kolonien, in Holland aus Indonesien, in Portugal aus Angola oder Mozambique, in England aus Pakistan. Dennoch gehört es in allen diesen Ländern zum politischen und gesellschaftlichen Konsens, dass es zuallererst die Aufgabe des Bildungssystems ist, diese Kinder, alle Kinder, in die jeweiligen Gesellschaften zu integrieren: durch Sprache, durch besondere Förderung in sozialen Brennpunkten, durch Öffnung der Schulen für Sozialarbeiter, Jugendhelfer, Psychologen, Ärzte, manchmal sogar Polizisten. Schließlich auch mit einem staatlichen Programm für den "nationalen Zusammenhalt" wie in Frankreich.
Nicht so in Deutschland. Hier zu Lande beginnt erst zaghaft eine Wahrnehmung, dass die Integration der Migranten nicht gelungen ist. Dass durch soziale und kulturelle Ausgrenzung eine neue Unterschicht entsteht, die sich allerdings fundamental von der alten Arbeiterklasse des 19. Jahrhunderts unterscheidet. Und dass das Bildungssystem bei der Verfestigung der Gesellschaftsstruktur eine zentrale Rolle gespielt hat und immer noch spielt.
Für die Zuweisung zu bestimmten Schulformen spielen vier Faktoren eine Rolle: die soziale Schicht der Eltern, das Wohnumfeld oder der Stadtteil, die ökonomische Lage der Familie oder der allein Erziehenden und schließlich die ethnische Herkunft. Englische und amerikanische Wissenschaftler pflegen bei der Benennung dieser Faktoren eine kurze und bündige Sprache. Die Merkmale der neuen "Underclass" oder "Working poor", so der Pulitzer-Preisträger David K. Shipler, sind "race", "class" und "gender".
Die deutschen Soziologen winden sich seit Jahren, nachdem sie die ersten Hinweise auf die ungebrochen starke soziale Selektion der Schule - von den Bildungsforschern Klaus Klemm und Rainer Lehmann - schlicht ignorierten. Noch Mitte der 90er Jahre meinten führende Industriesoziologen, auf Deutschland sei der Begriff "Underclass" (noch) nicht anzuwenden, so etwa Martin Kronauer. Wenige Jahre später führten Sozialwissenschaftler wie Heinz Bude für die ausgegrenzten, marginalisierten und in die rangniedrigsten Schulformen sortierten jungen Menschen einen Begriff ein, der ungeniert durch die Feuilletons wanderte: die Überflüssigen. Andere Kollegen wandelten den Begriff in die "Entbehrlichen" oder die "dauerhaft nicht Gebrauchten" ab.
Soziale Ungleichheitsforschung findet in Deutschland erst seit einiger Zeit wieder statt. Dies obwohl die internationalen Vergleichsstudien, aber auch nationale und regionale Schulforschungen - insbesondere von Rainer Lehmann und Wilfried Bos in Hamburg - eindringlich und nachdrücklich seit über zehn Jahren den Beitrag der deutschen Schulen an dieser neuen Schicht der so genannten "Überflüssigen" belegen. Das "Bildungsproletariat", wie es 2000 der damalige Bundespräsident Johannes Rau nannte und damit ein Tabu durchbrach, wird durch das System stabilisiert: durch Selektion und Ausgrenzung.
Die deutsche Schule integriert Kinder unterschiedlicher sozialer Milieus nicht, sondern sondert sie aus. Eher fassungslos stellten die Pisa-Forscher vor fünf Jahren fest, dass die Kinder der heutigen neuen Unterschicht genauso geringe Bildungschancen haben wie 1970 die klassischen Arbeiterkinder oder das bekannte katholische Mädchen vom Lande. Kommen zwei von drei Kindern aus der von den Pisa-Forschern so genannten oberen Dienstklasse wie selbstverständlich ins Gymnasium, so landen zwei von drei Kindern der Unterschicht in Sonderschulen, Hauptschulen oder deren Zweigen in der Sekundarschule. Von individueller Förderung des einzelnen Kindes, von Durchlässigkeit nach oben, von Aufstieg durch Leistung kann keine Rede sein.
Im Gegenteil: Auch nach der einschneidenden Weichenstellung nach der vierten Grundschulklasse setzt sich das Aussieben nach unten weiter fort. Jeder dritte Schüler wird in seinem Schulleben entweder einmal zurückgestellt, "quer versetzt" - das heißt auf eine Schulform tiefer verwiesen - oder bleibt sitzen.
Das Sortieren der Kinder und Jugendlichen nach der sozialen Herkunft hat in Deutschland aber noch eine weitere, nicht minder dramatische Folge: Je geringer das Ansehen der Schulform ist, umso weniger verfügen die Kinder und Jugendlichen über den Wissensstandard und die Kompetenzen, die in den OECD-Studien zu Grunde gelegt worden sind. Jeden vierten Pisa-getesteten Jugendlichen zählen die deutschen Forscher um Jürgen Baumert vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin im Jahr 2000 zur "Risikogruppe". Mit ihren 15 Jahren ist diese Gruppe über den Wissensstand der Grundschule nicht hinausgekommen. Drei Jahre später wird der nächste Pisa-Jahrgang belegen, dass der Abstand von oben und unten geblieben ist, die soziale Selektion unvermindert weitergeht, Jahr für Jahr.
Politik, Öffentlichkeit und Medien geben sich mit der Interpretation der Kultusminister und der Wissenschaftler zufrieden, dass das Leistungsgefälle im Gymnasium flacher geworden ist und das obere Drittel insgesamt im internationalen Vergleich aufgeholt hat. Was aus den 15-Jährigen im unteren Drittel, jenen "Risikogruppen" wird, interessiert offenkundig kaum jemanden. Eine wissenschaftliche Begleitung der Pisa-Getesteten gibt es in Deutschland nicht - nur Kanada und Australien finanzieren sie. Zur nationalen Gewissheit des Bürgertums - der oberen Dienstklassen, wie man heute sagt - gehört eben auch, an die Verlässlichkeit des dualen Systems und seine Integrationsfähigkeit zu glauben.
Das Ende auch dieser zweiten Gewissheit läuten nicht zuletzt das neue Berufsbildungsgesetz und die Arbeitsmarktreformen ein, die die rot-grüne Bundesregierung sowie der unionsdominierte Bundesrat zu verantworten haben und die unter dem Kürzel Hartz-Reform in die Politikbücher eingehen werden. Die Gesetzespakete, ergänzt im vorigen Jahr durch den nationalen Lehrstellen-Pakt, beenden die Illusion vom reibungslosen Funktionieren des deutschen Ausbildungssystems, vom nahtlosen Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf.
Sie beenden die fast zwanzig Jahre lang von allen Beteiligten in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sorgsam gepflegte Fiktion, dass es nur kleine Randgruppen sind, die Schwierigkeiten beim Übergang haben. Eine immer deutlichere Sprache spricht Jutta Allmendinger, die Leiterin des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg: "Wir müssen uns nicht um die Eliteförderung kümmern, sondern um die Bildungsarmut", sagt sie im August diesen Jahres. Sie weiß, wovon sie redet.
Seit dem Inkrafttreten der Gesetzespakete, seit der Neuordnung der gesamten Sozialgesetzgebung sprechen diejenigen, die am unmittelbarsten die Umsetzung beobachten, von einem "Strukturbruch": so Hans Dietrich vom IAB auf einem sozialpolitischen Workshop der IG Metall im Juli in Frankfurt. Nach dem Schulsystem sortiert nun die Sozialgesetzgebung die Jugendlichen in verschiedene Rechtskreise und trennt die Welten der "normalen" Jugendlichen und der "Hartz-IV"-Jugendlichen. Kurz gesagt: Wer aus einer Familie mit Langzeitarbeitslosigkeit, also einem Hartz-IV-Haushalt, kommt, für den ist nicht die allgemeine Berufsberatung zuständig, sondern für den gelten andere Übergangssysteme (und auch andere Zuständigkeiten) als für die "normalen" Jugendlichen, die eine Lehrstelle suchen.
Über eine Million Kinder und Jugendliche leben in den Bedarfsgemeinschaften nach Hartz IV, über 30 Prozent davon sind arbeitslos. Doch nicht genug damit. "Berufsvorbereitung" wird im Berufsbildungsgesetz institutionell verankert, wird also zu einem offiziellen Zwischenglied zwischen Schule und Lehrlingsausbildung. Für wen? Darauf verweist der Paragraph 242 des SGB III, in dem ein neuer Begriff der Zuweisung eingeführt wird: Neben die "lernbeeinträchtigen" treten die "sozial benachteiligten" Jugendlichen, die in Sondermaßnahmen der Berufsvorbereitung untergebracht werden können: 400 000 sind es inzwischen.
Dahinter, urteilt Hans Dietrich vom IAB, stehe kein pädagogisches Konzept, "sondern ein Verwaltungskonzept zur Zuweisung". Es zeichnet sich schon heute ab, dass es eine Zuweisung in eine Sackgasse sein wird. Nur zehn bis zwanzig Prozent der Jugendlichen in diesen Maßnahmen schaffen den Sprung in den Lehrstellenmarkt oder den ersten Arbeitsmarkt. Die übrigen wandern von Maßnahme zu Maßnahme und machen jene "Maßnahmenkarrieren", über die Nicole Kraheck oder Frank Braun im Deutschen Jugendinstitut forschen. Aus den Verlierern des Bildungssystems werden Verlierer des Ausbildungssystems: Irgendwann landen die jungen Männer und Frauen mit Migrationshintergrund oder aus den neuen Unterschichten-Milieus im prekären Sektor, aus dem heraus ein Aufstieg schwieriger geworden ist.
Erschwerend kommt hinzu: Jene Arbeiterkinder aus dem Jahr 1970 hatten einen Vorteil, den die heutigen Kinder der Unterschicht so nicht mehr haben: Sie hatten damals eine starke politische Lobby in der Sozialdemokratie, die das Bürgerrecht auf Bildung für ihre Kinder einforderte. Und sie hatten eine Lobby in den Gewerkschaften, die eine Chance sahen, aus dem Bildungssystem der Zuweisung auszubrechen. Die kämpferischste im DGB war damals eine Frau aus der CDU, tief geprägt von der katholischen Soziallehre: Maria Weber.
Dieser Lobby aus den 70er Jahren verdanken Arbeiterkinder, katholische Mädchen und Jungarbeiter ihren Aufstieg über den zweiten Bildungsweg - über das Abendgymnasium, die Bildungsstätten der Gewerkschaften, die Fernuniversität, die Akademie der Arbeit oder die Hochschule für Politik: Ein Politiker wie Gerhard Schröder gehört ebenso dazu wie der Daimler-Chef Jürgen Schrempp oder der ehemalige Arbeitgeberpräsident Hans-Olaf Henkel. Doch welche Schlüsse zieht die heutige politische Klasse aus ihren eigenen Erfahrungen? Wenig erkennbare. .