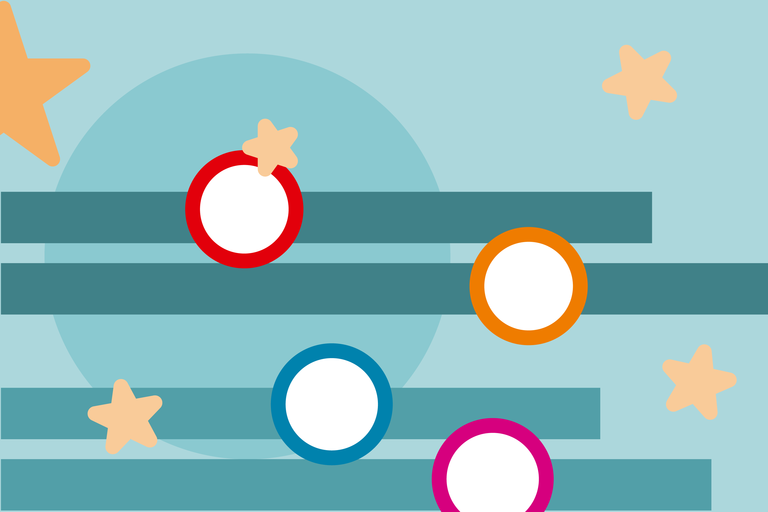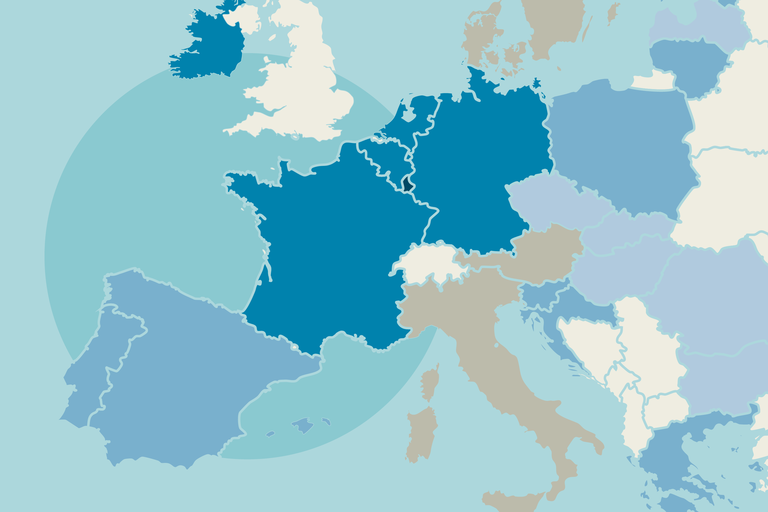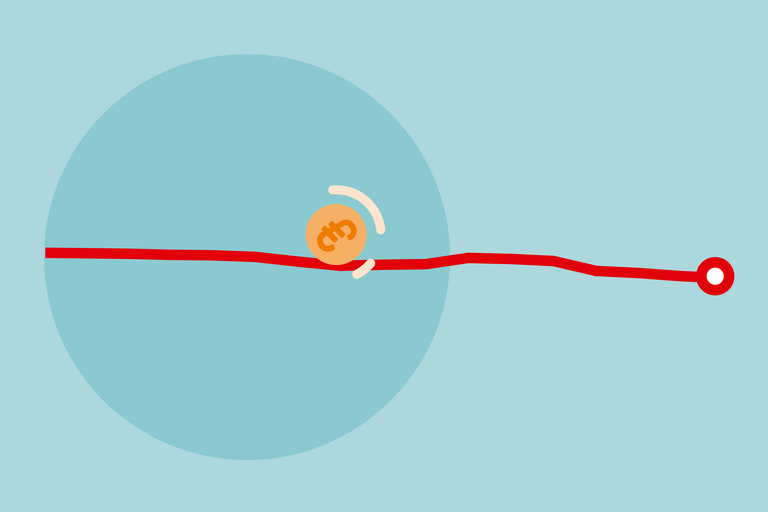: Pakt für Tarifautonomie
GESCHICHTE Das Stinnes-Legien-Abkommen vom 15. November 1918 war ein Bündnis auf Zeit, das schon nach wenigen Jahren zerfiel. Zugleich aber war es der Versuch eines fairen Interessenausgleichs zwischen Kapital und Arbeit.
Von KLAUS SCHÖNHOVEN, Historiker und bis 2007 Professor für Politik und Zeitgeschichte an der Universität Mannheim / Fotos: ullsteinbild
Am Beispiel Weimars lässt sich exemplarisch zeigen, dass eine Republik auf unsicheren Fundamenten steht, wenn sich nur das institutionelle Gefüge ihres Regierungssystems an den Normen der Demokratie orientiert, nicht aber ihre Gesellschaftsverfassung. Darauf hat bereits der sozialdemokratische Jurist Hugo Sinzheimer hingewiesen, der Mitglied der verfassungsgebenden Weimarer Nationalversammlung war. Er plädierte mit Nachdruck dafür, dass die parlamentarische Demokratie durch die soziale Demokratie ergänzt und abgesichert werden müsse.
Sinzheimer sprach Grundsatzprobleme einer demokratischen Verfassung an, die man in den Reihen der Republikgründer seit November 1918 monatelang kontrovers diskutiert hatte: War die mit dem Staatsumsturz revolutionär erkämpfte politische Demokratie stark genug, um sich auf Dauer der republikfeindlichen Kräfte in Wirtschaft und Gesellschaft erwehren zu können? Wie konnte verhindert werden, dass die alten Machteliten des Kaiserreichs das parlamentarische System eines Tages wieder aushebelten? Wer verfügte bei politischen oder sozialen Spannungen über die Autorität und die Kompetenz, um die Überlebensfähigkeit der republikanischen Staatsordnung zu sichern und zu garantieren? Welche institutionellen Vorkehrungen mussten in der Verfassung getroffen worden, um die politische mit der sozialen Demokratie fest zu verzahnen?
Zu den Akteuren, die für den sich später als brüchig erweisenden Weimarer Sozialstaatskompromiss die entscheidenden Weichen stellten, gehörten auch die Gewerkschaften. Ihr spektakulärer Schulterschluss mit den Arbeitgebern wenige Tage nach dem Staatsumsturz vom 9. November 1918 ist von zeitgenössischen Kritikern, aber auch von Historikern heftig kritisiert worden. Die Bandbreite der Urteile reicht von dem polemischen Verdikt, die Gewerkschaftsführer hätten einmal mehr die wahren Interessen der Arbeiterklasse verraten, bis hin zu der auch nicht besonders schmeichelhaften Feststellung, ihr naives Vertrauen in die Kooperationsbereitschaft der Unternehmer hätte die gewerkschaftlichen Verbandsführer dazu veranlasst, im Herbst 1918 dem Hirngespinst einer Sozialpartnerschaft zwischen Kapital und Arbeit blind hinterherzulaufen.
GENERATION DER PRAGMATIKER_ Man muss wissen, dass sich die wilhelminischen Gewerkschaftsführer als äußerst erfolgreiche Organisatoren einen Namen gemacht hatten. Ihr Verdienst war es, dass aus zersprengten und miteinander zerstrittenen gewerkschaftlichen Kleinverbänden eine machtvolle gewerkschaftliche Millionenbewegung entstanden war, die von der Großindustrie als ernst zu nehmender Gegner wahrgenommen wurde.
Die Gewerkschaften mussten sich an ihren zählbaren Erfolgen im täglichen Verteilungskampf zwischen Kapital und Arbeit messen lassen. Sie konzentrierten sich deshalb vor allem darauf, die oft noch miserablen Lohn- und Arbeitsbedingungen Schritt für Schritt zu verbessern. Diese zumeist wenig spektakuläre Tagesarbeit sahen die Verbandsführer als ihre Hauptaufgabe an, selbst wenn ihre Herzen für den sozialistischen Zukunftsstaat und eine gerechte Gesellschaftsordnung schlugen.
Mit den sozialrevolutionären Postulaten des Marxismus konnten sie wenig anfangen, weil sich dessen Krisen- und Katastrophenszenarien weder mit den Prämissen ihrer sozialreformerischen Praxis noch mit ihrem Gesellschafts- und Staatsverständnis zur Deckung bringen ließen. Dies galt insbesondere für das dialektische Diktum von Marx, wonach die Gewerkschaften einerseits den unvermeidlichen Kleinkrieg im bestehenden Lohnsystem zu führen hätten, andererseits aber zugleich als eine organisierte Massenbewegung zur Beseitigung der Kapitalherrschaft ihre ganze Kraft entfalten müssten. Diese antagonistische Definition des Doppelcharakters der Gewerkschaften als systemimmanente und als systemsprengende Bewegung konnte von ihnen nicht in eine plausible Handlungsstrategie umgesetzt werden, die den Widerspruch zwischen reformerischer Tagesarbeit und revolutionärer Umsturzorientierung überbrückte.
Im späten Kaiserreich stand auch deshalb die sozialdemokratische Gewerkschaftsbewegung - ebenso wie die christlichen und liberalen Richtungsgewerkschaften - mit beiden Beinen auf dem Boden der bestehenden Monarchie und trat für einen evolutionären Wandel des bestehenden Obrigkeitsstaates und der privatkapitalistischen Wirtschaftsordnung ein. Trotz der nach wie vor zwischen ihnen bestehenden ideologischen Differenzen handelten alle drei Gewerkschaftsrichtungen in Deutschland als soziale Reformbewegungen und erteilten einer revolutionären Systemüberwindung eine eindeutige Absage. Man hoffte auf eine gewaltfreie Bewältigung von Klassenspannungen in Staat und Gesellschaft und teilte miteinander das Grundvertrauen in die reformerische Entschärfung von Sozialkonflikten. Man glaubte an die Kraft der Vernunft und war davon überzeugt, dass die Unternehmermacht durch ein vielgestaltiges System der gewerkschaftlichen Mitsprache und Mitbestimmung kontrolliert werden könne.
DAS GEBOT DER STUNDE_ Im Ersten Weltkrieg verfestigte sich dieser programmatische Konsens der drei Gewerkschaftsrichtungen immer mehr. Die sozialdemokratischen Gewerkschaften reihten sich ebenso wie der christliche und der liberale Dachverband in die sogenannte Heimatfront ein, lehnten eine radikale Antikriegs- und Friedenspolitik entschieden ab, erklärten die unbedingte Loyalität zum Kaiserreich als das Gebot der Stunde, verzichteten für die Dauer des Krieges auf Streiks, proklamierten die Solidarität des Proletariats mit dem Vaterland und schworen ihre Mitglieder auf die patriotische Pflichterfüllung im Geiste des Burgfriedens ein.
Der seit August 1914 immer wieder bekundete gewerkschaftliche Kriegspatriotismus legte den Grundstein für einen Funktionswandel der Gewerkschaften und für ihre staatliche Anerkennung während der folgenden Jahre. Im Laufe des Krieges wurden sie von den Militärbehörden immer stärker in die Gesamtverantwortung für die kriegswirtschaftliche Mobilisierung des Arbeitskräftepotenzials und die möglichst reibungslose Ankurbelung der Rüstungsproduktion eingebunden. Der Staat bürdete ihnen die Verantwortung für die Zügelung und Disziplinierung der Arbeiterschaft auf und honorierte ihr nationales Engagement als Ordnungsmacht in der Kriegswirtschaft mit der Anerkennung ihres Rechtscharakters. Nach der Verabschiedung des Hilfsdienstgesetzes im Herbst 1916, das auch den gewerkschaftsfeindlichen Großindustriellen die tarifvertragliche Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmerverbänden vorschrieb, sahen sich viele Gewerkschaftsführer am Ziel ihrer Wünsche angelangt.
Allerdings überforderte die Doppelfunktion als kriegswirtschaftliche Hilfsorganisation der Monarchie und als Interessenorganisation der Lohnarbeiterschaft die Gewerkschaften permanent. Die in der zweiten Kriegshälfte immer sichtbarer werdende Vertrauenskrise zwischen Gewerkschaftsführung und Gewerkschaftsbasis, das Anwachsen der Kriegsmüdigkeit und der Friedenssehnsucht in der Bevölkerung und schließlich der Umschlag von Staatstreue in Staatsverdrossenheit im Herbst 1918 waren Vorzeichen des revolutionären Umbruchs, den die Gewerkschaftsführer nicht gewollt hatten. Alle drei Richtungsgewerkschaften lehnten den Massenaufstand gegen die Monarchie ab.
Der eindeutigste Beleg für diese antirevolutionäre Haltung der Gewerkschaften ist die von ihnen am 15. November 1918 vier Tage nach der deutschen Kapitulation im Wald von Compiègne mit den Unternehmern vereinbarte Allianz, die als "Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Deutschlands" (ZAG) in die Geschichte eingegangen ist.
Die gemeinsame Basis, auf der man sich hierbei fand, war der korporatistische Konsens zwischen den Unternehmern und den Gewerkschaftsführern, aber auch ihr antietatistisches und antirevolutionäres Selbstverständnis. Beides, die Ablehnung von weiterer staatlicher Gängelung und der Widerstand gegen die drohende revolutionäre Bevormundung durch spontan gebildete Arbeiterräte, verband den Großindustriellen Hugo Stinnes, der das ZAG-Abkommen für die Unternehmer unterzeichnete, und den Gewerkschaftsführer Carl Legien, der als Vorsitzender der Generalkommission der sozialdemokratischen Gewerkschaften die Allianz besiegelte.
KARTELL OHNE KONSENS_ Das Stinnes-Legien-Abkommen wurde am 15. November 1918 in einer Phase des dramatischen staatlichen Legitimitätsverlustes also mit einer doppelten Frontstellung abgeschlossen: Man wollte gemeinsam die ökonomischen und sozialen Interessen von Kapital und Arbeit vor dem weiteren Zugriff der im Krieg breit ausgebauten bürokratischen Zwangswirtschaft schützen. Zugleich war es Ziel, die Autonomie der Arbeitgeber und der Gewerkschaften als bestimmende Arbeitsmarktparteien auch vor den Ansprüchen der basisdemokratischen Rätebewegung und den politischen Revolutionswirren abzuschirmen. Es handelte sich um den selbstbewussten Versuch zweier einflussreicher Interessenorganisationen, sich auf dem Feld der Wirtschafts- und Sozialpolitik Aufgaben des modernen Staates anzueignen.
Doch zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern bestand kein belastbarer Grundkonsens, der einen fairen Interessenausgleich zwischen Kapital und Arbeit auf paritätischer Basis dauerhaft möglich gemacht hätte. Zwar feierten die Gewerkschaftsführer im November 1918 die Unterzeichnung des Stinnes-Legien-Abkommens als einen "Sieg von seltener Größe", weil es ganz auf der Generallinie ihrer sozialreformerischen und sozialpartnerschaftlichen Konzeption lag. Jedoch überschätzten sie die Belastbarkeit der Zentralarbeitsgemeinschaft. Ihr Symbolwert war sehr viel größer als ihre Substanz. Beide Seiten hatten das Arrangement mit der Gegenseite zu einem Zeitpunkt gesucht, als sie sich mit einer existenzbedrohenden Situation konfrontiert sahen: Die Arbeitgeber fürchteten ihre Enteignung und die Verstaatlichung der Großindustrie; die Gewerkschaftsführer fürchteten den revolutionären Tatendrang der Räte, deren radikale Stoßkraft sie weit übertrieben.
Aus der Sicht der Gewerkschaftsführer erfüllten die Arbeitgeber mit ihrer Unterschrift unter das Stinnes-Legien-Abkommen wichtige Forderungen, für die die Gewerkschaftsverbände seit Jahrzehnten hartnäckig gekämpft hatten. Dies waren: die Anerkennung der Gewerkschaften als legitime Interessenvertretung der Arbeiternehmer, denen die Unternehmer die volle gewerkschaftliche Koalitionsfreiheit garantierten; die allgemeine Einführung von kollektiven Arbeitsverträgen, die von den Gewerkschaften als Tarifpartner der Unternehmer mit Bindekraft für alle abhängig Beschäftigten ausgehandelt werden sollten; die Einrichtung von gemeinsamen Schlichtungsausschüssen und von paritätischen Arbeitsnachweisen; die Gründung von Arbeiterausschüssen in den Betrieben mit mehr als fünfzig Beschäftigten und die Ausschaltung der als Pseudogewerkschaften agierenden Werkvereine, deren Finanzierung die Unternehmer beenden wollten.
Von größter sozialpolitischer Bedeutung für die Gewerkschaften war, dass das ZAG-Abkommen den Achtstundentag einführte und dass die Arbeitgeberseite ausdrücklich konzedierte: "Verdienstschmälerungen aus Anlass dieser Verkürzung der Arbeitszeit dürfen nicht stattfinden." Für die Arbeiterbewegung stellte der Achtstundentag die wichtigste soziale Errungenschaft der Revolution dar. Allerdings handelte es sich bei ihm nur um ein Zugeständnis auf Zeit, dessen Widerruf vorprogrammiert war. Die Unterhändler der Gewerkschaften hatten sich nämlich darauf eingelassen, den Arbeitgebern zuzugestehen, dass der Achtstundentag in Deutschland nur dann dauerhaft Bestand haben könne, wenn diesem Beispiel auch international gefolgt werde. Damit hielten die Unternehmer von Anfang an eine Revisionsklausel in Händen, von der sie bereits ab Mitte 1919 in Tarifkonflikten Gebrauch machten, als sie die ersten Angriffe auf den Fortbestand des Achtstundentages einleiteten.
Am 9. November 1922, also auf den Tag genau vier Jahre nach dem Staatsumsturz von 1918, forderte Hugo Stinnes die Wiedereinführung des Zehn-Stunden-Tages ohne Lohnausgleich. Damit versetzte er der von ihm gemeinsam mit Carl Legien begründeten ZAG den Todesstoß. Anfang 1924 kündigten die Gewerkschaften endgültig die ZAG auf. Ohne den Rückhalt und die Mitwirkung des republikanischen Staates war fortan der Weg zur sozialen Demokratie verbaut. Diesen Weg wollten aber die Unternehmer nicht mitgehen, deren Kampf gegen "politische Löhne" am Ende der 1920er Jahre ihren Rückzug aus der Tarif- und Sozialordnung der Weimarer Republik einleitete.