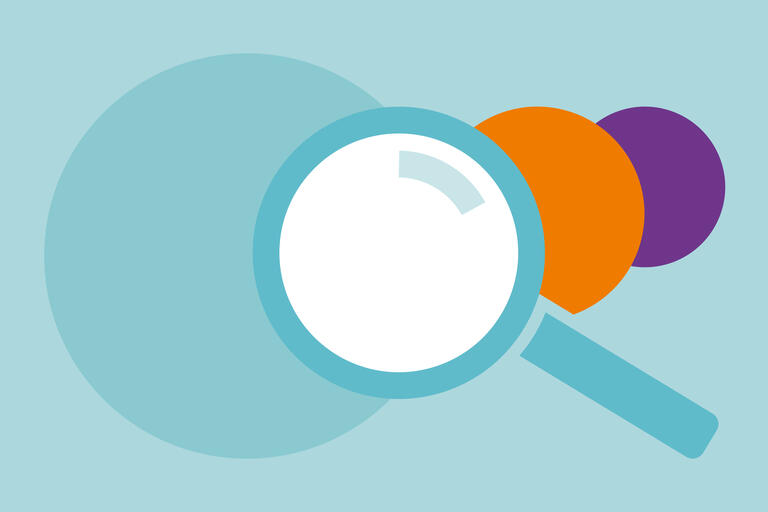: Ohne Ausbildung droht Ausgrenzung
Bildung und Ausbildung sind heute eine notwendige Ausstattung für gesellschaftliche Integration. Damit hat Bildung eine neue sozialpolitische Dimension gewonnen; nur darüber kann soziale Ausgrenzung vermieden werden.
Von Hermann Rademacker
Der Autor war wissenschaftlicher Referent am Deutschen Jugendinstitut in München; Schwerpunkt: die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule; Übergänge junger Menschen von der Schule in Ausbildung und Arbeit.
Wir leben in einer Bildungsgesellschaft. Solche Gesellschaften sind gekennzeichnet durch einen systematischen Zusammenhang zwischen zertifizierten Bildungsleistungen - wie Hauptschulabschluss, Abitur oder abgeschlossener Berufsausbildung - und der Besetzung von sozialen Positionen bzw. Arbeitsplätzen. Dieser Zusammenhang besteht in allen modernen westlichen Gesellschaften, und er ist Ausgangspunkt für die Studie von Heike Solga über die Erwerbschancen gering qualifizierter Personen heute.
Wie verlaufen Bildungsprozesse bis hin zu ihrer Zertifizierung? In welcher Weise bestimmen Bildungszertifikate den Zugang zu konkreten Arbeitsplätzen? Diese Fragen sind für die demokratische und soziale Qualität einer Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung: Denn heute sichert Bildung nicht mehr nur den Status gesellschaftlicher Eliten, sie ermöglicht nicht mehr nur einer Minderheit von Arbeiter- und Bauernkindern den sozialen Aufstieg aus ihren gesellschaftlichen Herkunftsverhältnissen.
Bildung ist zur notwendigen Ausstattung aller Mitglieder moderner Gesellschaften für die Sicherung ihrer sozialen Integration geworden. Bildung hat damit eine neue sozialpolitische Qualität gewonnen: Es geht nicht mehr nur - wie bis in die 1950er Jahre hinein - um Statuserhalt oder Aufstieg durch Bildung, sondern - und dies gilt insbesondere für die Schwächeren in der Gesellschaft - es geht um Bildung zur Vermeidung sozialer Ausgrenzung.
Dieser neue sozialpolitische Stellenwert von Bildung macht die Arbeit von Heike Solga so wichtig. Seit bildungssoziologische Untersuchungen der Frage der Chancengleichheit nachgehen, wissen wir: Die soziale Herkunft bestimmt weitgehend die Schulkarrieren junger Menschen. Das gilt in Deutschland wie auch anderswo. Gleichzeitig haben aber die beiden aktuellen PISA-Studien aufgedeckt, dass die Kopplung zwischen sozialer Herkunft und schulischer Kompetenzentwicklung in Deutschland am engsten ist.
Wenn wir Chancengleichheit als ein grundlegendes qualitatives Merkmal demokratischer Gesellschaften werten - und darüber sollte Einigkeit bestehen - dann bedeutet dies, dass das deutsche Schulwesen das am wenigsten demokratische im Vergleich der an der PISA-Studie beteiligten Nationen ist.
Wie legitim ist die Auslese durch die Schule?
Internationale Vergleiche der OECD weisen seit langem darauf hin: Jenseits von individuellen Voraussetzungen hängt die schulische Leistung junger Menschen in Deutschland stärker als in anderen Ländern von der jeweils besuchten Schule ab. Dagegen ist in Schweden und Finnland dieser Beitrag im internationalen Vergleich am geringsten. Nun nimmt in Deutschland der Staat einen besonders weitgehenden Einfluss darauf, welche Schule ein junger Mensch besucht - die frühe Auslese nach meist vier Grundschuljahren wirkt dabei zusammen mit der Aussortierung in die Sonderschulen am einschneidensten.
Während Kinder und Eltern in Finnland und Schweden unter weitgehend gleichmäßig bildungswirksamen Schulen frei wählen können, werden junge Menschen und ihre Familien in Deutschland in der Wahl unter offensichtlich sehr unterschiedlichen Schulen weitgehend staatlich gelenkt. Viele müssen hinnehmen, schließlich eine Schule zu besuchen, die sie nicht besuchen wollten und von der sie wissen oder wissen könnten, dass ihre Bildungschancen dort vergleichsweise eingeschränkt sind. Dies belegen die repräsentativen Befragungen des Instituts für Schulentwicklungsforschung der Universität Dortmund seit Jahrzehnten.
Zunehmend fragwürdig erweist sich die Legitimation, die der Staat für sich in Anspruch nimmt, um - in einem gegliederten Schulsystem - die Schulauswahl zu lenken. Diese Legitimation beruht auf der Annahme, dass die leistungshomogene Lerngruppe die beste Voraussetzung für einen optimalen Unterricht sei. Sie berücksichtigt nicht, dass den schwächeren Schülern nun die Ressourcen fehlen, die die stärkeren Schüler einbringen könnten - bei Letzteren handelt es sich entlang der Kopplung an soziale Herkunft meist um Kinder und Jugendliche aus "besseren Verhältnissen".
Dagegen legen internationale Leistungsvergleiche die Vermutung nahe: Die deutsche schulpädagogische Praxis hat sich mit ihrem Streben nach leistungshomogenen Lerngruppen der Herausforderung individueller Förderung weitgehend entzogen. Stattdessen hat sie die Selektion perfektioniert - und pädagogisch zu rechtfertigen versucht.
Insbesondere in den "unteren Etagen" des deutschen Bildungswesens entwickelt sich eine zunehmende Verfeinerung der Auslese. Dazu gehört die Unterschichtung der Hauptschule durch unterschiedliche Sonderschulformen. Neben den Einrichtungen für körperlich und geistig Behinderte haben den größten Anteil hier die Schulen für so genannte Lernbehinderte und - in geringerem Umfang - für junge Menschen mit psychosozialen Auffälligkeiten wie "Verhaltensstörungen" und "Erziehungsschwierigkeiten" - also für junge Menschen, deren Lernbeeinträchtigungen nicht selten mit sozialer Benachteiligung zusammenfallen.
In jüngster Zeit finden wir zusätzlich Differenzierungen "nach unten" innerhalb der Hauptschule. In Praxis-, Schub- und anderen Sonderklassen für Risikogruppen geht es um die besondere Förderung der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung - wobei oft aber der erfolgreiche Schulabschluss ausgeschlossen ist.
Ganz und gar außerhalb des Schulsystems etablieren sich zudem seit Mitte der 90er Jahre weitgehend wildwüchsig Angebote der Jugendhilfe für so genannte "Schulverweigerer". Diese rekrutieren ihre Klientel keineswegs systematisch und können daher auch nicht sicherstellen, dass ihre Angebote allen Jugendlichen mit einem entsprechenden Bedarf zugute kommen. Damit aber wird die Schule von der Herausforderung entlastet, auch für diese Jugendlichen ein angemessenes Angebot zu schaffen, und die Jugendhilfe schafft die ausgrenzendste Form der Beschulung, die es gibt.
Besorgnis erregende Mängel an demokratischer Qualität
Aber genau dieses Aussortieren wollten doch die Gesamtschulen vermeiden, die aus den Reformkonzepten der späten 60er Jahre hervorgingen. Heute wissen wir: Auch sie trugen durch die Fachleistungsdifferenzierung eher zu einer Perfektionierung der Auslese bei, statt sie zu überwinden. Wo es Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgängen des gegliederten Schulwesens gibt - etwa dort, wo in einer Schule mehrere Bildungsgänge oder Abschlüsse angeboten werden -, ist es vor allem eine Durchlässigkeit nach unten. All dies sind Hinweise auf erhebliche Mängel der pädagogischen wie auch der demokratischen Qualität des deutschen Schulwesens. Sie sollten in einer Gesellschaft, die auf ihre demokratische Entwicklung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit Recht stolz ist, Anlass zu erheblicher Beunruhigung sein.
Dies umso mehr als die bildungspolitische Debatte in der Folge der PISA-Studien Bildung vor allem als Humankapital definiert; dementsprechend wird die Mittelmäßigkeit der Schulleistungen der deutschen Schülerinnen und Schüler vor allem als Gefährdung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands thematisiert. Dagegen wird das im internationalen Vergleich auffällig große Demokratiedefizit des deutschen Schulwesens kaum diskutiert. Dies wäre aber gerade im Interesse der Risikogruppen - das sind in einer Bildungsgesellschaft zugleich Risikogruppen der Schule wie Risikogruppen des Arbeitsmarktes und der Gesellschaft als Ganzes - dringend geboten. Denn ihre Förderung verspräche einen wirksamen Beitrag zur Minderung sozialer Ungleichheit durch Bildung und zugleich eine Mehrung des Humankapitals.
Ein öffentliches Bildungswesen wie das deutsche rechtfertigt es keineswegs, die Ergebnisse schulischer Bildung allein den jeweiligen Personen als individuelle Leistungen zuzuschreiben und damit auch deren Arbeitsmarktchancen bzw. -risiken zu individualisieren. Das, was als schulische Leistung erscheint und zertifiziert wird, ist vielmehr das Ergebnis des Zusammenwirkens individueller Anstrengungen, unterschiedlicher privater Ressourcen - der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat dafür den Begriff des Kapitals um eine soziale und eine kulturelle Dimension erweitert - und last not least institutioneller Einflussnahme.
Die unterschiedlichen Chancen beim Zugang zu gesellschaftlichen und beruflichen Positionen dürfen deshalb keineswegs ausschließlich als der gerechte Lohn für individuelle Schulleistungen gewertet werden, denn diese sind nicht zuletzt auch das Ergebnis von Privilegierungen und Benachteiligungen durch eine im Schulsystem angelegte und in Deutschland besonders ausgeprägte ungleiche Verteilung von schulischen Bildungsgelegenheiten.
Bildungsdefizite setzen sich am Arbeitsmarkt fort
Bildung und ihre Zertifikate sind auf dem Arbeitsmarkt wichtiger geworden - geringwertige Zertifikate oder gar deren Fehlen gehen mit Beschäftigungsrisiken einher, die in diesem Ausmaß früher nicht existierten. Heike Solga betrachtet die Transaktionen am Arbeitsmarkt als Beziehung zwischen Angehörigen unterschiedlicher sozialer Gruppen - zumal, wenn gering Qualifizierte den Personalbeauftragten der Betriebe gegenüberstehen.
Die Personalauswahl der Betriebe bewertet Bildungszertifikate als Beleg für individuelle Leistungsbereitschaft und orientiert sich dabei auch an den Zertifikaten derer, die auf ähnlichen Arbeitsplätzen beschäftigt sind - auch wenn diese überqualifiziert sind. Auf der anderen Seite ist das Bewerbungsverhalten gering qualifizierter Arbeitssuchender durch die Diskreditierung bestimmt, die sie im Lebensverlauf in der Schule und auf den Arbeitsmarkt über lange Zeit erfahren haben. Es darf deshalb nicht verwundern, wenn sie ihre durch das Fehlen von Bildungszertifikaten belegte, mindere Leistungsfähigkeit sich auch selbst zuschreiben.
Damit akzeptieren sie gleichsam ihre Benachteiligung beim Zugang zu Arbeit als ausbleibende Belohnung für ausgebliebene (Schul-)Leistung und verhalten sich als Bewerberinnen und Bewerber entsprechend. So teilen sie den Glauben an die individuellen Ursachen ihres Scheiterns beim Zugang zu Erwerbsarbeit, was auch erklären könnte, dass ihre Ausgrenzung kaum von einem "Aufbau oppositioneller Solidarität", wie Solga es nennt, begleitet ist.
Wer von ihnen aber Glück hat und ohne abgeschlossene Ausbildung den Einstieg in Erwerbsarbeit schafft, ist ganz überwiegend an Arbeitsplätzen beschäftigt, die kaum Gelegenheit zu Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten bieten, um die Benachteiligungen beim Start in die Erwerbsarbeit zu überwinden. Folglich ist die Häufung von Benachteiligung auch im weiteren Verlauf der Erwerbsbiografie wesentlich wahrscheinlicher als ihre Kompensation.
Paradoxerweise hat nicht zuletzt die Bildungsexpansion zur Benachteiligung gering Qualifizierter am Arbeitsmarkt geführt, argumentiert Solga. Eine Benachteiligung, die sich am deutlichsten in ihrer seit Mitte der 70er Jahre massiv angestiegenen Arbeitslosigkeitsbetroffenheit ausdrückt. Denn mit der Ausweitung der Bildungsbeteiligung ist die Gruppe der "Zurückgebliebenen", die keine weiterführenden Schule besuchten oder keinen beruflichen Abschluss erreichten, kleiner geworden; damit nahm aber ihre Auffälligkeit und Stigmatisierung zu. Zugleich hat sich die soziale Zusammensetzung der Zurückgebliebenen deutlich verändert: Mädchen und junge Frauen nutzten die Gelegenheit zu Bildungsaufstiegen besonders stark, Jungen und Menschen mit Migrationshintergrund sind unter den Zurückgebliebenen überrepräsentiert.
Die Arbeit von Heike Solga ist mit ihrer bewussten Entscheidung für die Perspektive der Ausbildungslosen in der Bildungsgesellschaft ein hervorragendes Beispiel sozialpolitisch bewusster sozialwissenschaftlicher Forschung. Ihre Ergebnisse machen deutlich: Sozialpolitik muss heute einen Schwerpunkt in der Reform öffentlicher Bildung und Erziehung setzen. Anspruchsvoller Maßstab für den Erfolg einer solchen Reform wäre die spürbare Verringerung des Anteils derjenigen, die nicht den Mindeststandard für einen Erfolg versprechenden Zugang zum Beschäftigungssystem erreichen - Heike Solga sieht als solchen mit Recht den mittleren Bildungsabschluss.
Studie
Besprochen wird hier das jüngst erschienene Buch von Heike Solga: "Ohne Abschluss in die Bildungsgesellschaft", Opladen 2005.
Prof. Heike Solga war am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin tätig und hat seit 2005 eine Professur an der Universität Göttingen.