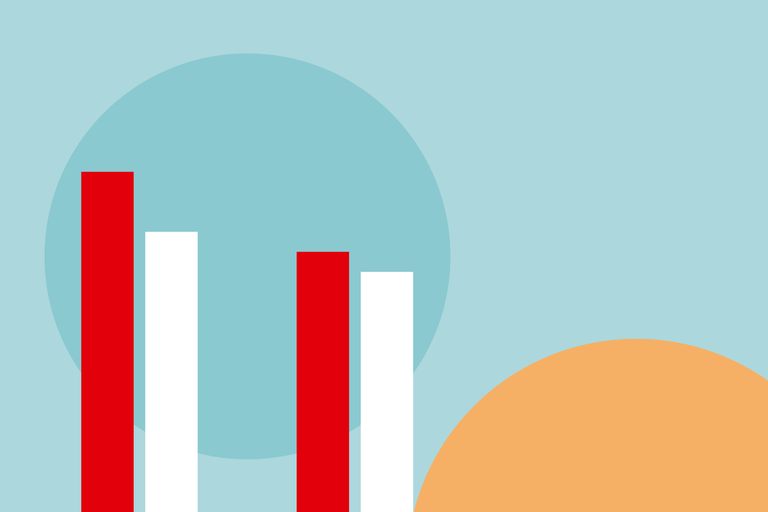Wachstumsdebatte: Muss die Wirtschaft schrumpfen?
Die Debatte um nachhaltigen Wohlstand erlebt eine Renaissance. Forschung und Politik versuchen zu klären, was ihn ausmacht und wie er sich messen lässt. Von Martin Kaluza
Als der Club of Rome 1972 seine Studie über die „Grenzen des Wachstums“ veröffentlichte, war das ein Paukenschlag. Die Botschaft der 17 beteiligten Forscher: Die Ressourcen der Welt sind endlich, und wenn die Menschheit weiter wirtschaftet wie gewohnt, gehen sie in weniger als 100 Jahren zur Neige. Finanziert worden war die am Massachusetts Institute of Technology (MIT) durchgeführte Studie von der Stiftung Volkswagenwerk. Ölkrise und autofreie Sonntage verstärkten in der Öffentlichkeit unmittelbar das Gefühl, dass die Sache ernst war.
Seither hat die Frage nach dem richtigen Wachstum, die Debatte um Fortschritt und Umweltverträglichkeit, um Verzicht und soziale Werte in Wissenschaft wie öffentlicher Wahrnehmung in wechselnder Gestalt Konjunktur. Die Gewissheit, dass unendliches Wachstum in einer endlichen Welt nicht zu haben ist, wurde zur Binsenweisheit. Dass Politik, Wirtschaft und Konsumenten sie verinnerlicht hätten, darf bezweifelt werden. Arbeitsmarktpolitik, die persönliche Karriereplanung, jeder Bausparvertrag, die Gewinnerwartungen an börsennotierte Unternehmen, der Ausbau erneuerbarer Energien „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“, der Bundesregierung – all das scheint auf dem festen Vertrauen aufzubauen, dass es wirtschaftlich nur aufwärtsgehen kann.
DAS BIP KENNT KEINE SCHÄDEN
Eine Renaissance der Diskussion um gesellschaftliche Wohlfahrt haben die Autoren der vom Umweltbundesamt in Auftrag gegebenen Studie „Wohlfahrtsmessung in Deutschland“ bereits vor der Krise 2007 ausgemacht. „Die Klimakatastrophe, der fortschreitende Verlust der Artenvielfalt und die Tatsache, dass zwei Milliarden Menschen die Armutsgrenze (bereits zu Beginn der einsetzenden Wirtschaftskrise) unterschritten haben, wurde als Versagen des Marktes trotz weltweit steigender Wirtschaftsleistung betrachtet“, schreiben die Autoren. „Die fortdauernde Orientierung am ‚produktivistischen Ansatz‘ kommt praktisch einer Beschleunigung gleich, indem Wachstumsroutinen befördert werden, die keine Abhilfe schaffen, sondern die Krisensituation im Großen und Ganzen verschärfen.“
Dass eine alleinige Orientierung am Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) bestimmte Probleme verschärft, ist kein Zufall. „Das BIP kennt keine Schäden“, erklärt Werner Sesselmeier, Wirtschaftsprofessor an der Uni Koblenz-Landau und einer der Referenten beim Stipendiatischen Dialog, einer gemeinsamen Veranstaltung von Hans-Böckler- und Friedrich-Ebert-Stiftung, im September in Springe. Ganz gleich, ob eine Ölplattform im Golf von Mexiko explodiert, eine Massenkarambolage auf der Autobahn Dutzende Fahrzeuge und die Gesundheit der Insassen ruiniert oder der Teilnehmer einer Demonstration eine Scheibe einwirft – diese Ereignisse gehen positiv in das BIP ein, weil sie Kosten verursachen, Arbeit und Zahlungsströme nach sich ziehen. Wonach also soll die Politik sich richten, wenn nicht nach dem Wachstum?
Eine 2011 einberufene Enquetekommission des Bundestages mit dem Titel „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ soll das klären. Ihre Aufgabe ist es, den Stellenwert von Wachstum in Wirtschaft und Gesellschaft zu ermitteln. Und sie soll ganz konkret einen Indikator entwickeln, der neben dem BIP weitere politische Zielgrößen beinhaltet – etwa soziale und ökologische. Es geht also letztlich um die Frage, wohin die Politik in den nächsten Jahren steuern soll. Der Abschlussbericht der Kommission wird 2013 erwartet.
Gert Wagner, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin und Mitglied der Enquetekommission, hält die Frage nach alternativen Indikatoren für „langweilig“. Er überraschte seine Zuhörer beim Stipendiatischen Dialog in Springe mit einer steilen These: „Kein Mensch tritt heute mehr für uneingeschränktes Wachstum ein. Die Politik steuert schon lange nach anderen Kriterien.“ Als das Münchner Institut für Sozialforschung im vergangenen Jahr Abgeordnete aus Bund, Ländern und Kommunen quer durch alle Fraktionen fragte, welche Indikatoren für ihre Arbeit wichtig seien, wurde die Arbeitslosenquote (83,5 Prozent) am häufigsten genannt, dicht gefolgt von der öffentlichen Verschuldung (80,2 Prozent). Mit einigem Abstand folgte die Inflationsrate (65,7 Prozent). Erst an vierter Stelle stand das Wachstum des BIP mit 61,7 Prozent. Allerdings bedeuten die Zahlen nicht, dass sich die Politiker verstärkt nach dem ökologischen Gleichgewicht, der Armutsschere oder Lebensqualität richten würden. Die gleiche Studie zeigt nämlich, dass die Politiker etwa der Armutsquote (48,6 Prozent) und dem ökologischen Fußabdruck (18,6 Prozent) deutlich weniger Bedeutung beimaßen als dem BIP.
WIE KOMPLEX darf EIN INDEX SEIN?
„Alternativen zum BIP gibt es, aber sie haben ihre Umsetzungsprobleme“, sagt Sesselmeier. Alle Indikatoren hätten einen Zielkonflikt gemeinsam: Sie sollen einfach und messbar sein. Gleichzeitig sollen sie sinnvolle Erweiterungen des BIP beinhalten. Der Human Development Index (HDI) der Vereinten Nationen berücksichtigt neben dem Pro-Kopf-Einkommen die Lebenserwartung und den Bildungsgrad. Der Happy Planet Index kombiniert den ökologischen Fußabdruck mit Lebenszufriedenheit und Lebenserwartung. Das vom „DenkWerk Zukunft – Stiftung kulturelle Erneuerung“ unter Meinhard Miegel entwickelte „Wohlstandsquintett“ setzt sich zusammen aus dem Pro-Kopf-BIP, der Einkommensverteilung, einer gesellschaftlichen Ausgrenzungsquote, ökologischem Fußabdruck und der öffentlichen Verschuldung.
Noch komplexer ist der unter der Leitung von Joseph Stiglitz, Amartya Sen und Jean Paul Fitoussi entwickelte OECD Better Life Index. Gleich elf Dimensionen soll er unter einen Hut bringen, unter anderem Wohnsituation, Einkommen, Arbeit, Gesundheit, Sicherheit und Work-Life-Balance. Sesselmeier hält einen solchen Index für kaum umsetzbar. Stiglitz, Sen und Fitoussi hätten selbst noch gar keine Berechnungen auf der Basis ihres Modells durchgeführt. „Zudem bieten große Modelle wie dieses der Politik viele Möglichkeiten, sich aus der Verantwortung zu stehlen, indem sie Einzelaspekte gegeneinander aufrechnet“, sagt Sesselmeier. „Sie könnte sagen: ‚Ihr habt zwar keine Arbeit, aber ihr seid gesund‘.“
Unterdessen steigt der Druck, den Ressourcenverbrauch zu senken und vom BIP-Wachstum zu entkoppeln. Das Problem Klimawandel, das stellte auch eine Projektgruppe der Enquetekommission fest, wird sich nicht dadurch von selbst entschärfen, dass die Ressourcen zur Neige gehen. Die Menge der verbleibenden fossilen Energieträger ist so groß, dass sie in der Atmosphäre riesigen Schaden anrichten können. Seit der Rio-Konferenz 1992 hatte die Politik vor allem auf die Steigerung der technischen Effizienz gesetzt. Doch die hat sich als weniger wirksam erwiesen als erhofft. Ein Gutachten zur Entkopplung von Naturverbrauch und Wirtschaftswachstum, das die Enquetekommission in Auftrag gegeben hatte, konstatiert, dass, „obwohl bei einigen Ressourcen der Verbrauch weniger schnell stieg als das BIP (relative Entkopplung), so gut wie nirgends eine Abnahme des Ressourcenverbrauchs (absolute Entkopplung) stattfindet“.
Ein Grund dafür ist der sogenannte Rebound-Effekt: Ein erheblicher Teil der möglichen Ressourceneinsparungen wird dadurch wieder zunichte gemacht, dass die bessere Effizienz zu mehr Nachfrage führt. Beispiele lassen sich in allen Lebensbereichen finden: Ein Autofahrer kauft sich ein sparsameres Auto, fährt dann aber weitere Strecken. Fernsehbildschirme verbrauchen weniger Energie, doch die Kunden schaffen immer größere Geräte an, und ein Teil der Einsparung wird wieder aufgefressen.
DIE ÖKOLOGISCHE IST DIE SOZIALE FRAGE
Eine der wenigen Erfolgsgeschichten schreibt derzeit die Ökostrombranche. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat durch garantierte Stromabnahmepreise Anreize geschaffen, etwa Solar- und Windparks auszubauen. Garantierte Vergütungen haben sie zu lohnenden Investitionsobjekten gemacht. Die erneuerbaren Energien sind inzwischen die zweitwichtigste Quelle der Stromerzeugung. 2011 betrug ihr Anteil bereits 20 Prozent – 1998 waren es erst 4,7 Prozent gewesen. Damit haben die Erneuerbaren erstmals die Atomenergie überholt. Roland Zieschank vom Forschungszentrum für Umweltpolitik an der FU Berlin sieht darin ein Beispiel, dass Finanzmarkt und Nachhaltigkeit keine unvereinbaren Gegensätze sind. „Wir haben enorme Mittel im Finanzmarkt. Die Frage ist, wie sie sich für die Green Economy nutzbar machen lassen“, sagt er.
Zugleich ist die Stromerzeugung ein Paradebeispiel dafür, dass sich die ökologische Frage nicht von der sozialen trennen lässt. So steht aktuell die EEG-Umlage in der Kritik. Sie verteilt die Kosten, die aus der Förderung der erneuerbaren Energien entstehen, auf die Endverbraucher. Stromkunden bezahlen ab 2013 pro Kilowattstunde einen Aufschlag von 5,277 Cent (2012 waren es 3,59 Cent). Dass besonders stromintensive Betriebe eine Sonderregelung in Anspruch nehmen können – sie zahlen dann nur noch eine EEG-Umlage von 0,05 Cent pro Kilowattstunde –, erhöht die Belastung der Privatstromkunden.
Welche Einbußen soll man dem Einzelnen zumuten? Ein Teil der Wachstumsdebatte drehte sich schon immer um die Frage, ob die Lösung der Umweltprobleme nicht sogar in wirtschaftlicher Schrumpfung liegt. Retten wir den Planeten nur durch Verzicht? „Ich halte diese Theorien für krude“, sagt Dierk Hirschel, Bereichsleiter der Abteilung Wirtschaftspolitik beim ver.di-Bundesvorstand. „Wir müssen als Gesellschaft fragen, in welchen Bereichen Bedarfe bestehen. Brauchen wir mehr Kitas? Wollen wir weniger Spritfresser? Diese Ziele gilt es zunächst einmal umzusetzen. Wenn das am Ende zu weniger Wachstum führt, dann sehe ich darin kein Problem.“
Ohnehin droht dem Wachstum noch von ganz anderer Seite Gefahr. „Die Krise hat Jahre des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts zunichte gemacht“, schreibt die EU-Kommission in ihrer Mitteilung „Europa 2020“. Europaweit sank das BIP im Krisenjahr 2009 um vier Prozent, die Industrieproduktion fiel auf das Niveau der 1990er Jahre zurück, und die Arbeitslosigkeit in der EU stieg auf über zehn Prozent (2007 waren es 7,5 Prozent). Ursula Engelen-Kefer, ehemals DGB-Vize und heute im Kuratorium der Friedrich-Ebert-Stiftung, sagt beim Stipendiatischen Dialog: „Die Finanzmärkte treiben uns vor sich her. Wenn wir überhaupt wieder politischen Spielraum haben wollen, müssen wir den Primat der Finanzmärkte brechen.“
Mehr Informationen
ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik: Studie zur Wahrnehmung und Berücksichtigung von Wachstums- und Wohlfahrtsindikatoren. 2011.
Hans Diefenbacher/Roland Zieschank/Dorothee Rodenhäuser: Wohlfahrtsmessung in Deutschland – Ein Vorschlag für einen nationalen Wohlfahrtsindex. 2010.
Reinhard Madlener/Blake Alcott: Herausforderungen für eine technisch-ökonomische Entkoppelung von Naturverbrauch und Wirtschaftswachstum. 2011.
Europäische Kommission: Europa 2020. Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. KOM(2010) 2020 endgültig, 3. März 2010.
Webseite der Enquetekommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“.
OECD Better Life Index von Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean Paul Fitoussi.