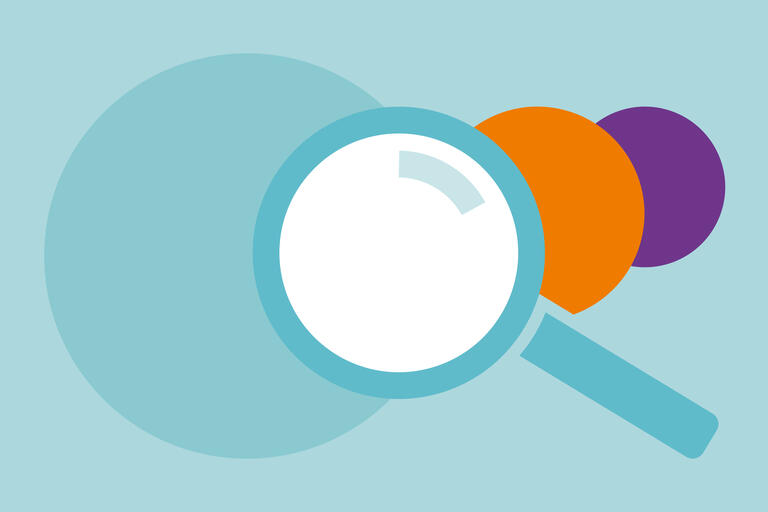: INTERVIEW 'Für unsere Gesellschaft sieht es düster aus'
Klaus Peter Strohmeier forscht über Familien in sozialen Brennpunkten und sieht Armut, Verwahrlosung und schlechte Gesundheit. Was brauchen die Kinder und die Jugendlichen, die in den Armutsmilieus der Städte aufwachsen?
Die Fragen stellte Annette Jensen.
Gut Ausgebildete bekommen immer weniger Nachwuchs, zugleich wächst die Kinderarmut in Deutschland. Was heißt das für die Zukunft des Landes?
In den Städten sehen wir heute eine starke Polarisierung. In einigen Vierteln leben überwiegend kinderlose Erwachse; in Köln und München sind inzwischen die Mehrheit der Haushalte Einpersonenhaushalte. Diese Bevölkerung hat durchschnittlich ein hohes Bildungsniveau. Dagegen konzentrieren sich kinderreiche Familien der Unterschicht und Migranten in den armen Stadtteilen und in den Großsiedlungen des sozialen Wohnungsbaus. Dann gibt es noch das ländliche Umland, wo überwiegend Mittelschichtfamilien leben. Hier ist das durchschnittliche Qualifikationsniveau der Bevölkerung inzwischen deutlich höher als in den Kernstädten.
Wie müsste eine sinnvolle Familien- und Sozialpolitik vor diesem Hintergrund aussehen?
Es gibt im Grunde zwei Familien- und Kindheitskontexte in Deutschland. Das wird in den gegenwärtigen sozialpolitischen Debatten überhaupt nicht aufgegriffen. Da gibt es dann nur Rürup, der sagt: Kinderbetreuung verbessern und die Schwelle zum ersten Kind senken. Das aber trifft nur einen Teil der Wirklichkeit.
Welche Perspektive wäre denn angemessener?
Im Getto sind Armut, Verwahrlosung der Kinder und schlechte Gesundheit oft das Problem. Für viele gibt es keine Chance, überhaupt einen Arbeitsplatz zu erreichen. Hier muss man ansetzen. Wenn es so ist, dass es nur noch in der Unterschicht normal zu sein scheint, Kinder zu bekommen, dann müssen wir verstärkt in ihre Bildung und Ausbildung investieren. Nur so kann man sicherstellen, dass sie die Kompetenzen erwerben, die unsere Gesellschaft nun einmal braucht, um existenzfähig zu sein.
Doch bei den letzten Bundestags- und Landtagsdebatten wurde immer wieder ein ganz anderes familienpolitisches Thema ins Zentrum gestellt: Dass man eigentlich was gegen die Kinderlosigkeit der Mittelschicht tun müsste, weil sich nur noch die Unterschichten fortpflanzen und das zu einer Unterschichtung der Gesellschaft führen würde.
Halten Sie die Anstrengungen zur Vereinbarung von Familie und Beruf für überflüssig?
Nein, es ist sinnvoll, Kinderbetreuung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Doch das allein wird nicht reichen, damit Akademikerinnen garantiert mehr Kinder bekommen. In bestimmten Milieus wie zum Beispiel in Wissenschaftlerkreisen ist es heute normal, keine Kinder zu haben. Da ist es fast erklärungsbedürftig, wenn sich jemand doch dazu entschließt. An solchen Einstellungen kann man kurzfristig nichts ändern.
Erst wenn insbesondere junge, gut ausgebildete Frauen in ihrer Umgebung sehen, dass sie nicht so leben müssen wie ihre Mütter und ihresgleichen Spaß und Freude mit Kindern und Beruf haben, werden sich wieder mehr dafür entscheiden. Zurzeit aber erleben gerade gut Ausgebildete die Familie als eine sehr traditionelle und benachteiligte Lebensform.
Was also tun, damit Deutschland mehr und besser ausgebildeten Nachwuchs bekommt?
Es muss heute vor allem darum gehen, die gegenwärtige Entwicklung zu gestalten. Es ist eine problematische Perspektive, wenn es sich eine Gesellschaft leistet, dass sie ihre nachwachsende Generation überwiegend aus dem Armutsmilieu rekrutiert. Viele Stadtkinder haben heute Bildungsdefizite, und sie erfahren Umweltbedingungen, die einem gedeihlichen Heranwachsen nicht förderlich sind. Wir werten im Moment die Schuleingangsuntersuchungen verschiedener Großstädte aus.
Der Gesundheitszustand von Schulanfängern unterscheidet sich sozialräumlich extrem. In den bürgerlichen Vierteln sind 80 Prozent der Kinder vollständig gesund, in den Großsiedlungen sind es nur 10 bis 15 Prozent. Bestimmte Krankheiten wie motorische Störungen und Übergewicht häufen sich in so genannten sozialen Brennpunkten. Da gibt es Kinder, die nicht mehr rückwärts gehen oder auf einem Bein stehen können. An solchen Problemen muss man ansetzen.
Sollte der Staat regelmäßige medizinische Vorsorge für Kleinkinder anordnen?
Viel wichtiger als medizinische Prävention ist es, die Eltern mit einzubeziehen. Solche Defizite haben ja oft was zu tun mit defizitärem Lebensstil. Eltern, die als Kinder nicht erfahren haben, was Kinder brauchen, können es ihren Kindern auch nicht geben. Deshalb ist es extrem wichtig, Kinder, Frauen und Männer nicht jeweils isoliert in den Blick zu nehmen, sondern zusammen als Familie.
Und was passiert, wenn das unterbleibt?
Dann sind die sozialen Grundlagen unserer Gesellschaft gefährdet. Davor hat bereits vor elf Jahren die Expertenkommission im 5. Familienbericht der Bundesregierung gewarnt. Die Grundthese: Jede Gesellschaft braucht nicht nur Humankapital - beruflich hinreichend qualifizierten Nachwuchs -, sondern auch Humanvermögen, also Nachwuchs, der mit bestimmten elementaren Fähigkeiten und Motiven ausgestattet ist: Solidarität, Empathie, Gesundheit, Partizipationsbereitschaft.
Die Kommission wies darauf hin, dass solche Kompetenzen in der Familie gelegt werden. Die Familie macht so etwas wie eine Grundausbildung für alle anderen gesellschaftlichen Bereiche. Ohne Familie könnten weder das Schulsystem noch Wirtschaft oder Politik existieren, weil es kein handlungsfähiges Personal gäbe. Heute wächst die Mehrheit der Kinder in den Städten unter Bedingungen auf, die es eher unwahrscheinlich macht, dass sie diese Kompetenzen, Motive und Fähigkeiten in dem Maße erwerben, um später ausreichend handlungsfähig zu sein.
Aber Familie gilt in Deutschland als privater Raum. Was kann der Staat machen, wenn Familie als Lernort oft nicht mehr funktioniert?
Viele Familien in diesen Vierteln sind sozial isoliert, weil die Fluktuation in den Armutsstadtteilen sehr hoch ist. Man kann sagen, dass sich die Bevölkerung hier statistisch innerhalb von vier Jahren komplett ausgetauscht hat. Da ist es besonders wichtig, soziale Orte zu schaffen, wo Familien auch zusammenkommen können, damit nicht jeder nur in seinen vier Wänden vor der Glotze sitzt. Was mich ärgert ist, dass es gute Beispiele aus der Praxis gibt, was man hier tun kann, aber kaum jemand jenseits der eigenen Stadtgrenze etwas davon weiß.
Geben Sie uns doch mal ein Beispiel.
In Gelsenkirchen gibt es eine fantastische Gesamtschule in Trägerschaft der evangelischen Kirche, die es bei 40 Prozent Migranten schafft, keinen Jugendlichen ohne Abschluss zu entlassen und wo es keinen Vandalismus gibt - bei Ökobauweise des Schulgebäudes. Der Hausmeister muss abends um sechs die Schüler rausschmeißen, weil sie gerne in der Schule sind. Es gibt viele Verbindungen der Schule in dem Stadtteil, und die Eltern partizipieren - einschließlich der türkischen Mütter und Väter. Das zeigt, dass man eine Schule benutzen kann zur Weiterentwicklung eines ganzen sozialen Milieus. Schulen und Kindergärten sind regelmäßige Anlauforte und deshalb besonders geeignet, um solche Prozesse zu ermöglichen.
Wie funktioniert so etwas konkret?
Wir haben mal eine Untersuchung gemacht zu Elternarbeit im Kindergarten - und wie sie das Erziehungsverhalten beeinflusst. Das Ergebnis: Wo die Eltern aus unterschiedlichen Milieus kommen und tatsächlich etwas zusammen machen, sind die Unterschichteltern weniger restriktiv mit ihren Kindern. Sie lesen ihnen mehr vor und spielen andere Spiele als wenn Unterschichteltern es nur mit ihresgleichen zu tun haben. Wichtig ist es oft, dass Menschen in Kontakt kommen.
Plädieren Sie für eine Kindergartenpflicht?
Ob eine Kindergartenpflicht politisch durchsetzbar ist, ist fraglich. Ich finde aber, dass man darüber reden sollte - aber nur unter der Voraussetzung, dass es gelingt, die Eltern einzubeziehen. Im Prinzip ist der Ansatz ab dem dritten Lebensjahr schon deutlich zu spät, wenn man die gesundheitlichen Gefährdungen betrachtet.
Was bedeutet es, wenn sich die gegenwärtigen Strukturen verfestigen?
Der Jugenddezernent einer Ruhrgebietsstadt hat vor kurzem berichtet, dass er viele Stadtteile hat, in denen die Kinder keine Chance haben, auch nur einen Erwachsenen zu kennen, der regelmäßig arbeitet. In diesen Stadtteilen ist es gefährlich, öffentliche Räume zu betreten. Das führt dazu, dass es normal ist, anderen eher mit einem gewissen Misstrauen zu begegnen und sich rauszuhalten, wenn Beteiligung verlangt wird. Weil die Mehrheit der Kinder unter solchen Bedingungen aufwächst, sehe ich recht schwarz für die sozialen Existenzgrundlagen unserer Gesellschaft. Außerdem verlässt in bestimmten Bereichen der Städte heute etwa ein Drittel der jungen Leute die Schule ohne Abschluss und damit ohne Qualifikation. Oft geht es direkt von der Schule in die Sozialsysteme.
Hauptsache Arbeit ist das Motto der Politik, Ein-Euro-Jobs liegen im Trend. Halten Sie es für sinnvoll, auf niedrig qualifizierte Jobs zu setzen?
Ich glaube, Arbeit ist sehr wichtig für das Selbstwertgefühl der Menschen - und überhaupt ein Job ist oft besser als keiner. Ich denke auch, dass es für Kinder eine wichtige Sozialisationserfahrung ist, dass man sein Geld durch geregelte Arbeit verdient und das Geld nicht einfach vom Amt kommt. Aber wir können es uns nicht leisten, dass sich Geringqualifizierung sozial vererbt.
Die Babyboomer gehen ab 2015 nach und nach in Rente. Dann schrumpft das Erwerbspersonenpotenzial rasant. Wir werden dann ein großes Qualifikationsproblem haben, weil viele junge Leute von heute nicht anständig ausgebildet sind. Deshalb müssen wir heute alles daransetzen, dass all diejenigen, die heute oder künftig ins Bildungssystem eintreten, tatsächlich mit einer verwertbaren Qualifikation wieder rauskommen.
Ihre zentrale Forderung an die Politik?
Familien- und Bildungspolitik müssten verzahnt, Jugendhilfe und Schule nicht von unterschiedlichen Ministerien verwaltet werden, wie es jetzt nach dem Regierungswechsel hier in NRW wieder der Fall ist. Stattdessen müsste man Schulen auch als offene Einrichtungen für Kinder und Familien im Stadtteil nutzen. Und sie sollten offen sein für privates Engagement wie zum Beispiel Bildungspatenschaften von Senioren und Schülern, wie es zum Beispiel in Essen gut funktioniert. So etwas kostet nichts und bringt viel. Man muss das Engagement nur einsammeln und bündeln. Ich glaube, es mangelt oft gar nicht so sehr am Geld, sondern an der Kenntnis und Umsetzung guter Ideen. Und viel hängt von engagierten Personen ab.
Wo sehen Sie gesellschaftliche Kräfte, die in die richtige Richtung wirken?
Es gibt sehr engagierte Kirchengemeinden wie zum Beispiel in Gelsenkirchen-Hassel, wo 70 Prozent Türken wohnen und der evangelische Pfarrer versucht, alle Bevölkerungsteile und örtlichen Akteure vom Anglerverein bis hin zur Gewerkschaftsjugend zusammenzubringen. Auch in der Wohnungswirtschaft gibt es bereits Ansätze, wieder gemischtere Milieus zu fördern. Der Antrieb ist klar: Leerstand, Fluktuation und Vandalismus in den Armutsvierteln sind teuer. In Bielefeld ist das zum Beispiel in einem innenstadtnahen ehemaligen Kasernengelände gelungen.
Und die Gewerkschaften?
An den früheren Zechenstandorten war der gewerkschaftliche Organisationsgrad ja traditionell sehr hoch, und diese Stadteile wurden dann oft einige Jahre nach der Zechenstilllegung zu sozialen Brennpunkten. Ich habe den Eindruck, dass diese Themen die Gewerkschaften auf Kongressen schon sehr interessieren, zum Thema Bildung hat die GEW erst vor kurzem in Bochum eine riesige Veranstaltung organisiert. Wie stark die Gewerkschaften auf der örtlichen Ebene in Erscheinung treten, kann ich nicht sagen.
Wie optimistisch sind Sie, dass Deutschland die Kurve kriegt?
Ich wäre gerne optimistischer. Ich mache ja viel politiknahe Forschung, und die Ergebnisse liegen seit Jahren auf dem Tisch. Aber Politik funktioniert leider anders - sehr kurzfristig am Wahlzyklus orientiert und nach Ressortzuständigkeiten gegliedert. Es fehlt eine integrierte Sicht auf die Dinge. Sozialstruktur, Stadtentwicklung, demografische Entwicklung, Bildung, Integration von Migranten - all das hängt miteinander zusammen. Und mit Vorschlägen, die "bessere Schulen für Türken" fordern, würde man die Wahlen bestimmt eher verlieren als gewinnen.
Zur Person
Klaus Peter Strohmeier ist Professor für Stadt- und Regionalsoziologie an der Ruhr-Uni Bochum. Er untersucht seit vielen Jahren die Bevölkerungsentwicklung im Ruhrgebiet - im Kontext der Familien- und Sozialpolitik.