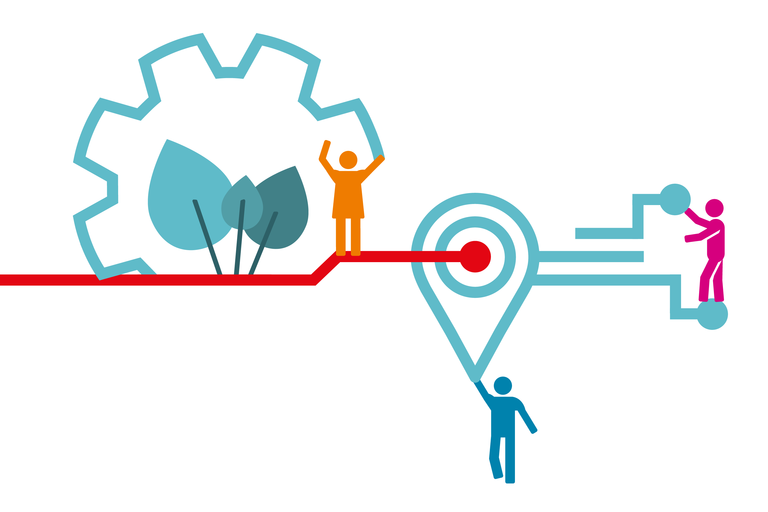Quote: Fair beteiligt, aber selten an der Macht
Die 2001 eingeführte Quote im Betriebsverfassungsgesetz wird in fast 80 Prozent der Betriebe umgesetzt. Und immerhin sind heute ein Drittel der Betriebsräte in Deutschland weiblich. Von Carmen Molitor
Google kann mit dem Suchwort nichts anfangen: „Meinten Sie: Betriebsrat?“, fragt der Internetsuchdienst, wenn man „Betriebsrätin“ eingibt. Erstaunlich eigentlich, denn so selten sind Frauen in der Arbeitnehmervertretung gar nicht mehr. Seit den letzten Betriebsratswahlen im Jahr 2010 besetzen sie knapp ein Drittel der Mandate in den Betriebsratsgremien und kommen damit dem Frauenanteil in den Belegschaften näher, konstatiert der „Trendreport Betriebsratswahlen 2010“ der Hans-Böckler-Stiftung. Dazu trage die „gute Erfüllungsquote der Minderheitengeschlechterquote nach dem Betriebsverfassungsgesetz zweifellos bei.“
Für die Quote hatten sich Gewerkschaften und Frauenpolitikerinnen bei der Reform des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) 2001 starkgemacht, weil Frauen in den Organen der betrieblichen Mitbestimmung deutlich unterrepräsentiert waren. Seither bestimmt §?15 im Absatz 2, dass „das Geschlecht, das in der Belegschaft in der Minderheit ist“, zumindest entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat vertreten sein muss, wenn dieser aus mindestens drei Mitgliedern besteht. Das gilt in Betrieben ab 20 Beschäftigten. Da die Industrie männerdominiert ist, wirkt das Gesetz dort faktisch als Frauenquote, in frauendominierten Branchen – Handel, öffentlicher Dienst oder Gesundheitsbereich – umgekehrt als Männerquote. Bei der ersten Betriebsratswahl nach den neuen Genderregeln 2002 stieg der Anteil an Frauen in den Betriebsräten auf 23,3 Prozent (2010: 25,7 Prozent). Der Anteil der Betriebe ab 20 Beschäftigten, in denen die Geschlechterquote erfüllt wurde, lag damals bei 71,2 Prozent (2010: 79,7? Prozent). Seither gilt: Je größer ein Betrieb und damit ein Betriebsrat, umso eher wird die Quote eingehalten; kleine Betriebe dagegen bleiben in Sachen Geschlechtergerechtigkeit Problemkinder. Auch eine andere statistisch belegte Faustregel deutete sich 2002 an: Erfolgreiche Frauen ziehen andere Frauen nach. Wo es weibliche Betriebsratsvorsitzende gibt, steigt insgesamt der Frauenanteil im Gremium.
MOTOR IN DEN GREMIEN
Wie hat sich die Geschlechtergerechtigkeit elf Jahre nach der Quoten-Einführung entwickelt? „Relativ erfreulich“, findet die IG Metall: „Obwohl der Frauenanteil bei den Beschäftigten im Organisationsbereich der IG Metall von 2002 bis 2010 gesunken ist, blieb der Frauenanteil bei den Betriebsräten mit 22,8 Prozent konstant“, analysiert Iris Becker, Ressortleiterin Frauen- und Gleichstellungspolitik. Dadurch hätten Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Entgeltgerechtigkeit mehr Schub bekommen, sagt Becker. „Da sind unsere Betriebsrätinnen ein Motor in den Gremien.“ Wo es immer noch im IG-Metall-Bereich hakt: Nur 15,2 Prozent der Freigestellten sind Betriebsrätinnen. Selbst das Interesse von Frauen an Teilfreistellungen ist um sechs Prozent auf unter 17 Prozent gesunken, dabei wurde diese Option 2001 auch deshalb ins BetrVG genommen, um mehr Engagement von Müttern zu ermöglichen.
Die größte Baustelle der Gendergerechtigkeit ist und bleibt jedoch der geringe Frauenanteil bei den Betriebsratsvorsitzenden (13,6?Prozent) und stellvertretenden Vorsitzenden (18,8?Prozent). Paradoxerweise haben Frauen dort die geringste Aussicht auf eine Führungsposition, wo sie die besten Chancen haben, überhaupt in einen Betriebsrat zu kommen: in Großbetrieben. So gibt es in den 50 Unternehmen mit mehr als 5000 Beschäftigten im Organisationsbereich der IG Metall lediglich eine weibliche Vorsitzende – bei Siemens Erlangen. Eine gläserne Decke, die Iris Becker aber ganz allmählich aufbrechen sieht: „Wir kriegen mehr Frauen in die Betriebsratsspitzen rein, auch zunehmend in Aufsichtsräte“, verbreitet sie Zuversicht.
„Es bewegt sich etwas“, zieht auch Cornelia Leunig von der IG BCE eine positive Bilanz der Minderheitenquote. Doch auch nach ihrem Geschmack engagieren sich noch zu wenige Frauen in den Führungspositionen der Gremien. Leunig hält die persönliche Ansprache für den besten Weg, mehr Kandidatinnen für Betriebs- und Aufsichtsräte zu gewinnen. „Auch Personalentwicklungsprogramme im Betriebsrat machen wirklich Sinn. Wenn diese greifen, dann schaffen wir es auch, dass mehr Frauen Vorsitzende werden.“ Die IG BCE setze nicht auf weitere Quoten oder gesetzliche Regelungen, sondern auf freiwillige, aber verbindliche (Sozialpartner-)Vereinbarungen. Und auf mehr Bewusstsein für Gleichberechtigung.
SPITZENREITER VER.DI
Die Organisation mit dem mit Abstand größten Frauenanteil in den Belegschaften und in den Betriebsratsgremien ist ver.di. Auch in den von ver.di vertretenen Branchen hat die Minderheitenquote kontinuierlich für mehr Mandatsträgerinnen gesorgt – beachtliche 45,9 Prozent im Jahr 2010, bei allerdings einem durchschnittlichen Anteil wahlberechtigter Frauen von über 50 Prozent. Immerhin sind bei ver.di 39 Prozent der Betriebsratsvorsitzenden Frauen. Häufiger übernehmen Frauen die Stellvertretung (46 Prozent). Ein beliebtes Duo ist also der Mann als Vorsitzender und die Frau als Stellvertreterin. Wo aber im ver.di-Organisationbereich Belegschaften frauendominiert sind, hat das Gesetz den Männern einen fairen Anteil in den Gremien beschert. Welche Motivation Frauen haben, in männerdominierten Branchen in die Betriebsratsarbeit zu gehen, erforschte Constanze Kurz, heute tätig in der Vorstandsverwaltung der IG Metall, für das SOFI in Göttingen 2009. „Die im Betriebsrat engagierten Frauen sind meist in den mittleren Jahren, gut ausgebildet und sehr stark motiviert“, berichtet die Gewerkschafterin. „Sie sehen, dass es ab 40 schwierig wird, die Karriereleiter weiter zu erklimmen. Da ist Betriebsratsarbeit eine attraktive Alternative – was Freiheitsgrade, Themen und auch was soziales Engagement angeht. Sie treffen eine Entscheidung für ein Stück persönliche Weiterentwicklung.“
Im Alltag der Betriebsratsarbeit müssen sie sich in das vorhandene Beziehungsgeflecht einpassen. „Manche schieben einen hohen Frust. Denn um an interessante, verantwortungsvolle Aufgaben im Gremium kommen zu können, braucht es ein Netzwerk“, berichtet Constanze Kurz. Eine Quote, so ihre Schlussfolgerung, sei auch heute noch der einzige Weg, dafür zu sorgen, dass Frauen auch in den Führungspositionen der Betriebsräte selbstverständlicher werden. Google hat es auch gelernt: Bei der nächsten Recherche hatte sich das System „Betriebsrätin“ schon gemerkt.
VERLIEREN, OHNE AUFZUGEBEN
Achterbahn war letztes Jahr. Die Situation, in der die Westdeutsche Landesbank seit Anfang 2012 ist, beschreibt Konzernbetriebsratsvorsitzende Doris Ludwig mit einem anderen Begriff: Schussfahrt. „Es geht nur noch nach unten“, sagt sie etwas müde, aber nicht bitter. Erstaunlich humorvoll, offen und charmant wirkt die 53-Jährige, obwohl sie eine brutale Zeit hinter sich hat. 2011 trieb die KBR-Vorsitzende noch die Hoffnung um, dass die angeschlagene Bank mit ihren weltweit 4300 Arbeitsplätzen wenigstens teilweise zu retten sei. Gemeinsam mit ihren beiden Stellvertretern hatte Ludwig dafür an vielen Schrauben gedreht: Das Trio unternahm eine Roadshow zu Politikern in Düsseldorf, Berlin und Brüssel, um klarzumachen, dass an der Entscheidung menschliche Schicksale hängen und es sinnvolle Alternativen zur Auflösung der Bank gebe. Sie legten den Arbeitgebern ein beschäftigungssicherndes Konzept nach §?92a BetrVG vor, setzten Hoffnung in einen neuen Investor, der Interesse gezeigt hatte. Sogar den EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia besuchten sie, begleitet vom ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske und mit zwei dicken Fotoalben mit Porträts der Beschäftigten unter dem Arm. Es half alles nichts: Kurz vor Weihnachten 2011 verkündete Almunia die Zerschlagung der Bank, die durch riskante Geschäfte in eine existenzielle Krise geraten war. Doris Ludwig kehrt nun die Scherben auf.
Die Betriebsrätin stammt aus dem 1200-Seelen-Ort Bausendorf in der Südeifel. Im nahen Wittlich machte sie Abitur und absolvierte eine Lehre bei der Raiffeisenbank, wurde schnell Geschäftsstellenleiterin. Seit der Schulzeit schlug Ludwigs Herz für Politik: „Ich habe einen hohen Anspruch an Gerechtigkeit und war immer da, wo Minderheiten sind“, erzählt sie. Als Jugendliche engagierte sie sich bei den Jusos, war später lange die einzige Frau in Gemeinde- und Verbandsgemeinderat. Sie trat in die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen ein und gründete den ersten Betriebsrat in ihrer Bank. Als „rote Krawallschachtel“ sei sie damals in der erzkatholischen Gegend bekannt gewesen, lacht Doris Ludwig. Es habe ihr schon immer Spaß gemacht, gegen den Strich zu bürsten.
Ludwig verließ die Bank und ging als Gewerkschaftssekretärin der HBV nach Düsseldorf. Das Paradeunternehmen mit den besten Dienstvereinbarungen in ihrem Zuständigkeitsbereich war die öffentlich-rechtliche WestLB, die damals Sozialdemokrat Friedel Neuber als Patriarch alter Schule führte. „Damals habe ich immer gesagt: Wenn ich noch mal auf die Welt komme, werde ich Personalrat bei der WestLB“, erinnert sich die 53-Jährige und ergänzt trocken: „Dass mich Ähnliches wirklich mal ereilt, konnte ich ja nicht ahnen?…“ Nach zehn Jahren wechselte sie tatsächlich in die WestLB, als Gleichstellungs- und später als Diversitybeauftragte. Sie wollte das Genderthema voranbringen und hatte wieder Lust darauf, in einem Unternehmen zu arbeiten, erklärt sie das.
2006 kehrte Doris Ludwig ins Arbeitnehmerlager zurück: Auf einen Schlag wurde sie Vorsitzende des Betriebsrates und des Konzernbetriebsrates und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der WestLB. Ihr Vorgänger und seine Stellvertreterin traten beide nicht mehr zu den BR-Wahlen an. Sie, die immer den Kontakt zum Betriebsrat gehalten hatte, kam ins Gespräch. Die selbstbewusste Frau sagte unter einer Bedingung zu: Sie wollte Vorsitzende werden. „Das war sehr vermessen, denn ich war ja bisher nicht mal Mitglied des Betriebsrates gewesen“, sagt sie rückblickend. Aber wenn schon, dann wollte sie auch die Richtung bestimmen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Doris Ludwig schaffte es aus dem Stand an die Spitze.
Sie fand sich in einem 25-köpfigen Betriebsrat mit sechs Freigestellten wieder – und fremdelte. Nun stand sie einem Apparat vor, dessen Abläufe den Personalbereich der Bank im Kleinen abbildeten. „Da ging es nicht mehr darum, kreativ zu sein, sondern darum, Dinge abzuarbeiten, zack, zack, eine Mappe gegen die andere“, erinnert sie sich. „Das fiel mir nicht leicht.“ Sie lernte, Schwerpunkte zu setzen und sich nicht in zu vielen Ausschüssen zu zerreiben. Lernte, dass manch freundliches Wort ihrer Funktion galt und nicht ihrer Person. Und sie lernte, den Spagat zwischen ihren Rollen im Aufsichtsrat und im Betriebsrat zu machen, ohne dabei den Kontakt zur eigenen Basis zu verlieren.
Über das Betriebsverfassungsgesetz musste sie nichts lernen, das kannte sie genau. Vieles daraus half ihr in der Krisenzeit – wie zum Beispiel die Möglichkeit nach §?111, bei Betriebsänderungen externe Berater hinzuziehen zu dürfen. „Wir könnten diese komplexen Themen sonst gar nicht wuppen.“ Das Informationsrecht des Betriebsrates dagegen hätte sie lieber genauer definiert. „Der Arbeitgeber war immer der Meinung, dass er uns ‚rechtzeitig und umfassend‘ informiert hat. Dabei waren wir immer am Ende der Informationskette“, sagt Ludwig.
Als Frau an der Spitze zu sein war für sie nie ein Problem, erzählt die KBR-Vorsitzende. „Ich nutze Charme und meine Diplomatie sehr offensiv, um mir Zugänge zu verschaffen.“ Diese Zugänge braucht sie auch in Zukunft. Zwar sind Interessensausgleich und Sozialplan für die 451 Beschäftigten, die in eine Verbundbank wechseln, die in die Hessische Landesbank eingegliedert wird, fertig. Aber diesem Kraftakt folgt der nächste: Beim Rechtsnachfolger der WestLB, Portigon, sollen 2016 nur noch 1000 Beschäftigte arbeiten, dann will das Land NRW verkaufen. Für Ludwig heißt das: Personalabbau begleiten und über Vergütungsstrukturen und Arbeitsbedingungen verhandeln. Ein Betriebsratskonzept zur Beschäftigungssicherung mit Ideen für Portigon ist in der Mache. „Damit“, sagt Doris Ludwig, „werden wir wieder auf politisch Verantwortliche aller Couleur zugehen, versuchen, diese zu überzeugen, und um deren Unterstützung werben.“ Aufgeben gilt nicht.
"SEHR OFT KANN MAN NUR SCHADEN BEGRENZEN"
Es gibt Momente, da wünscht sich Waltraud Litzenberger ihre Zeit als Betriebsratsvorsitzende zurück. „Damals haben mein Niederlassungsleiter und ich per Handschlag etwas vereinbart, und das hat gehalten“, erzählt sie. 17 Jahre ist das her. Litzenberger ist seitdem weit gekommen: Seit vier Jahren leitet sie in der Deutschen Telekom AG den Konzernbetriebsrat und den Europäischen Betriebsrat und hat seit 1999 ein Mandat als Aufsichtsrätin. Ihr Gegenüber ist jetzt das obere Management, Vereinbarungen schließt man schriftlich, und oft gehört es zum Geschäft, um einzelne Worte zu streiten und zu hören: Nein, so war diese Formulierung aber bei den Verhandlungen nicht gemeint. „Dann denke ich manchmal: Ach, was war das doch so schön damals“, lächelt Waltraud Litzenberger.
„Ich bin ein Telekom-Gewächs“, sagt sie von sich. Mit 18 begann sie ihre Beamtenlaufbahn bei der Deutschen Bundespost in einem Fernmeldeamt, engagierte sich ab Anfang der 80er Jahre als Vertrauensfrau der damaligen Postgewerkschaft. Sie brachte eine Tochter zur Welt, arbeitete als freigestellte Bezirkspersonalrätin. Mitte der 90er Jahre, als sich ihr Arbeitgeber zu einem börsennotierten Unternehmen wandelte, übernahm sie das erste Mal den Vorsitz in einem Betriebsrat. Es bedurfte allerdings aller Überzeugungskunst ihres Vorgängers, bis sie sich nominieren ließ. „Ich habe immer gesagt, ich kann das nicht. Wie das so viele Frauen tun“, erinnert sich Waltraud Litzenberger. „Aber er hat mich sehr angeschoben.“ Einen Rat ihres damaligen Mentors befolgt sie bis heute: Man muss sich konsequent positionieren. Jedem wohl und keinem wehe, das geht als Betriebsratsvorsitzende nicht.
Ihre Arbeit ist über die Jahrzehnte spannend geblieben, aber anstrengender und verantwortungsvoller geworden. „Wir sind ein sehr großer, zentralistisch geführter Konzern, sodass im Konzernbetriebsrat viele Themen zu bearbeiten sind, die Tausende von Menschen betreffen“, erzählt sie. Ihrem Mitarbeiterteam sei sie deshalb eine fordernde Chefin, die zwar auch Freiheiten zulasse, aber konsequent Ergebnisse erwarte. „Wir müssen hier Vorbild sein, weil alle ringsum auf uns gucken.“ Alle? Das sind die Manager, die Anteilseigner, die Beschäftigten, die anderen Betriebsräte. Vielleicht ist es dieses Bewusstsein, das sie gegenüber Fremden zu einer zwar konzentrierten und aufmerksamen, aber auch vorsichtigen, eher reservierten Gesprächspartnerin macht. Sie sagt nicht mehr, als sie wirklich preisgeben will. Noch weniger mag sie öffentliches Aufheben um ihre Person. Interviews gibt sie selten, obwohl viele Medien anfragen. „Ich habe eine Funktion, und die ist intern“, erklärt sie ernst. Es sind in der Tat viele interne Positionen, die sie besetzt – Gremienvorsitze, Ausschussmitgliedschaften, Aufsichtsratsposten. Jeder Arbeitstag ist randvoll mit Terminen, Besprechungen, Koordinationsarbeit, selten dauert er weniger als zwölf Stunden. Voraussetzung dafür, so ein Pensum durchzuhalten, sind die Fähigkeit zu strukturiertem Arbeiten und Mitarbeiter, auf die sie sich blind verlassen kann. Beides habe sie.
Die Hauptfelder, die sie seit dem Börsengang der Telekom 1995 als Arbeitnehmervertreterin beackern muss, sind dieselben geblieben: die stetige Umstrukturierung des Konzerns, Standortschließungen, zentrale Interessensausgleiche. Mal war die größtmögliche Aufsplitterung der Unternehmensbereiche für das Management der Stein der Weisen, aktuell erlebt die One-Company-Strategie eine Renaissance. Das zentrale T-Thema war und ist aber der Personalabbau. Ende 2011 hatte der Konzern weltweit 235 000 Beschäftigte, davon nur noch 121 000 hierzulande. „Seit der Privatisierung sind jedes Jahr fast 10 000 Arbeitsplätze abgebaut worden“, sagt Litzenberger. Das verlief einigermaßen sozialverträglich, oft über Abfindungen. Ohne Mitbestimmung und die Verständigung von Betriebsräten, Gewerkschaften und Management hätte das so nicht funktioniert, glaubt Litzenberger. Hier zeige sich aber auch die ständige Gratwanderung der Betriebsratsarbeit: In welchen Bereichen kann man mit dem Arbeitgeber gemeinsame Konzepte erarbeiten, und wo geht das aus Prinzip nicht? Sie ist da Pragmatikerin: „Es steht im Vordergrund, welche Verbesserungen wir für die Beschäftigten erreichen können“, betont die KBR-Vorsitzende. „Aber oft sind es gar keine Verbesserungen. Sehr oft kann man nur Schaden begrenzen, die Folgen von Entscheidungen abmildern.“ Frust? Sie lacht kurz auf. „Wenn ich damit nicht mehr umgehen könnte, wäre es an der Zeit, zu sagen: Jetzt ist es gut.“ Aufgeben ist für sie keine Option. Das war es auch nicht, als 2008 publik wurde, dass das Management Betriebsräte und Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmerseite während der Ära von Konzernchef Kai-Uwe Ricke systematisch bespitzeln ließ. „Das hat uns alle erschüttert“, sagt sie. Es muss sehr schwer gewesen sein, danach zu der vom Betriebsverfassungsgesetz geforderten vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber zurückzukehren.
Mehr gesetzlich geregelte Mitbestimmung würde Waltraud Litzenberger – „als Wunschdenken“ – befürworten, damit die Beschäftigten mehr Einfluss auf die vielen Organisationsänderungen im Konzern oder auf die Verlagerung von Arbeit ins Ausland hätten und entschiedener bei der Bezahlung von Leih- und Zeitarbeitern mitsprechen könnten. „Aber wenn ich mehr Mitbestimmung will, beispielsweise bei Standortschließungen, will ich dann die Frage nach einer Änderung des Wirtschaftssystems stellen? Nein, das will ich natürlich nicht“, stellt sie klar. Man erziele auch so Erfolge, zuletzt hätten einige Gesamtbetriebsräte erreicht, dass wieder mehr Arbeit in den Konzern integriert worden ist, statt Leiharbeiter zu beschäftigen. Ihr Büro in der Bonner Konzernzentrale verlässt die KBR-Vorsitzende meist spätabends, geht zu Fuß zu ihrer nahe gelegenen Zweitwohnung und kehrt morgens früh ins Büro zurück. Erst freitags fährt sie heim zu ihrem Mann nahe Bingen am Rhein und erholt sich davon, immer auf dem Posten zu sein.
"WIR MÜSSEN NACH VORNE GEHEN!"
Susanne Herberger klingt erleichtert: „Ich finde gut, dass der Schritt gemacht wird!“, sagt die stellvertretende Konzernbetriebsratsvorsitzende der ThyssenKrupp AG. Gestern hatte der Vorstandsvorsitzende Heinrich Hiesinger öffentlich erklärt, dass er die Notbremse für ein Projekt ziehen wird, das den größten deutschen Stahlkonzern tief in die roten Zahlen gerissen hatte: Das Unternehmen prüfe „alle Optionen“, sich von den Stahlwerken zu trennen, die es in Brasilien und den USA gebaut hat. Höchste Zeit für diesen Strategiewechsel, findet Herberger. Denn was in Amerika als Investition in neue Märkte gedacht war, hatte sich längst zu einem Fass ohne Boden entwickelt, in dem wegen immer neuer Bauverzögerungen und Pannen Milliarden verschwanden. Geld, das für Forschung, Entwicklung und Innovationen in den anderen Geschäftssparten des Gesamtkonzerns – bei den Aufzügen, dem Anlagenbau, den Automobilzulieferern und Werften sowie im Stahl- und Edelstahlbereich – spürbar fehlte, wie Herberger schon lange mit Sorge beobachtete. „In der Vergangenheit sind Probleme oft einzeln und getrennt voneinander behandelt worden“, beschreibt sie die Lage. Der neue Vorstandsvorsitzende Hiesinger, seit 2011 im Amt, treibe dagegen endlich eine Strategie voran, die alle sechs Geschäftsbereiche gleichberechtigt berücksichtige. „Wir unterstützen ihn da sehr“, sagt die stellvertretende Konzernbetriebsratsvorsitzende.
Erst seit März hat Susanne Herberger diese Position. Zuvor erlebte sie den Konzern als Mitarbeiterin und Betriebsrätin der ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, eines deutschen Unternehmens der weltweit agierenden ThyssenKrupp Elevator, die weltweit 46 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt – mehr, als die Stahlbereiche des Konzerns mit 33 000. Eine tragende Säule, die weitgehend geräuschlos erfolgreich arbeitet.
Herberger, Jahrgang 1964, ist in einer Ingenieursfamilie in Leipzig aufgewachsen. Als Jugendliche hat sie gerne gemauert, Fliesen gelegt oder genäht, Hobbys, bei denen am Schluss etwas Greifbares entsteht. In den 80er Jahren studierte sie Informatik und arbeitete bei der Takraf, einem DDR-Kombinat für Tagebau-Ausrüstungen, Kräne und Förderanlagen. Sie wechselte zum Sächsischen Bühnen- und Stahlhochbau nach Dresden, wo sie heute noch mit ihrem Mann lebt. Nach der Wende übernahm Thyssen Aufzüge ihren Betrieb. Als die erste Aufschwungeuphorie verflogen war, gründete sie mit ihren Kollegen einen Betriebsrat, deren Vorsitzende sie zwei Jahre später wurde. Ihr wichtigster Erfolg damals war, gemeinsam mit der IG Metall einen Tarifvertrag mit Thyssen-Aufzüge für die neuen Niederlassungen in Dresden, Erfurt und Leipzig auszuhandeln. Und sie hatte es geschafft, einen Großteil der Belegschaft, die nach der Wende geschlossen aus der DDR-Pseudogewerkschaft ausgetreten war, von einer Mitgliedschaft in der IG Metall zu überzeugen. Erfolge wie dieser motivierten Susanne Herberger, sich 2006 für den Vorsitz im Gesamtbetriebsrat der ThyssenKrupp Aufzüge GmbH und den Vorsitz der Betriebsräte-Arbeitsgemeinschaft ThyssenKrupp Elevator zu bewerben: „Als ich gemerkt habe, dass man etwas erreicht und mitbestimmen kann, da hat es mich gereizt, noch eine Stufe weiterzugehen.“ Ihr Vorgänger ermunterte sie zur Kandidatur, Kollegen und ihr Ehemann unterstützten sie. Doch Susanne Herberger zögerte: War sie, „die gerne auf einer sachlichen Ebene arbeitet“, überhaupt politisch versiert genug für diese Position? Konnte sie das ausfüllen? Sie kann, hat sie in den vergangenen sechs Jahren ihrer Freistellung festgestellt. Auch wenn es ein anstrengender Job ist, bei dem die GBR-Vorsitzende ständig zwischen den Standorten in Deutschland unterwegs ist und oft aus dem Koffer lebt. Susanne Herberger ist als Frau und als Angestellte in einer männer- und arbeiterdominierten Branche weit gekommen, bestimmt seit Jahren auch im Konzernaufsichtsrat, in den Aufsichtsräten der ThyssenKrupp AG und der ThyssenKrupp Elevator AG mit. Eine zielgerichtete, warmherzig wirkende Macherin, die nicht viel Aufhebens um ihre Person macht. Keine selbstverständliche Karriere in einem Konzern, der in den ersten vier Führungsebenen einen Frauenanteil von sechs Prozent hat. Auch in den insgesamt 23 Betriebsratsgremien bei ThyssenKrupp Elevator gibt es außer Herberger nur noch vier weibliche Vorsitzende. Als starke Persönlichkeit, die sich gut in geschickter Interessenvertretung verstehe, beschreiben sie Kollegen. Sie sei absolut pragmatisch und anerkannt – im Kollegenkreis und auf Arbeitgeberseite. Ihre Kompetenz und ihr spezifischer Blick von der Technologiesparte auf das große Ganze hat sie jetzt auch im Konzernbetriebsrat zu einer gefragten Führungspersönlichkeit gemacht.
Die Betriebsrätin hat ThyssenKrupp als ein Unternehmen mit einer entwickelten Mitbestimmung kennengelernt und entsprechend viel Gestaltungsspielraum. Lediglich bei Outsourcing und Fremdvergabe an Subunternehmer wünscht sich Susanne Herberger noch mehr Rechte für die Arbeitnehmervertreter. Eines ihrer Ziele ist jetzt, den Konzernbetriebsrat mehr zu einem Arbeitsgremium umzugestalten und mit den Kollegen bereichsübergreifende Projekte anzugehen. Herberger mag es, Lösungen zu suchen und sie dann zügig anzupacken. Auch in diesem Sinne schmeckt ihr die Entscheidung des Vorstands, die Stahlwerke in USA und Brasilien abzustoßen. „Wir müssen nach vorne gehen“, betont die Betriebsrätin, „ein Stagnieren darf nicht sein.“ Für den Gesamtkonzern, da ist sie sicher, sei in dieser Sache ein Ende mit Schrecken auf jeden Fall besser als ein Schrecken ohne Ende.
Text: Carmen Molitor, Journalistin in Köln / Foto: Schmidt-Dominé