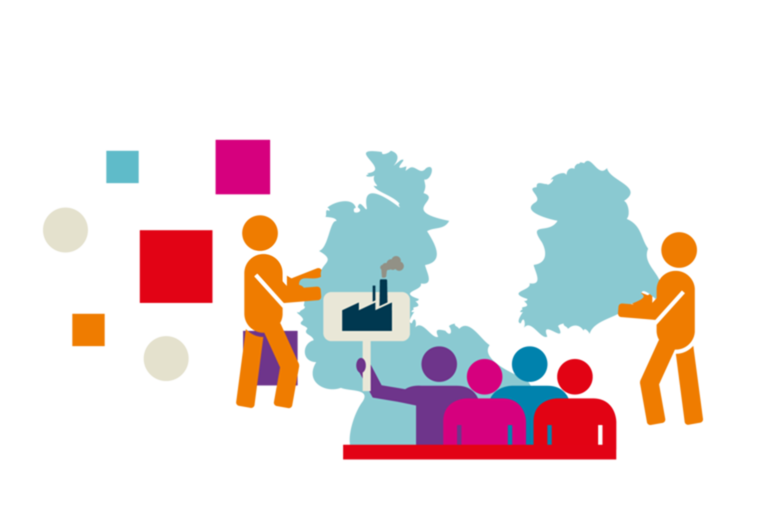: Auch Herr von Pierer konnte irren
Von Wolfgang Müller Der Autor ist bei der IG Metall Bayern zuständig für die IT-Branche und den Siemens-Konzern. wolfgang.mueller@igmetall.deWährend sich die Medizintechniker von Siemens in den vergangenen Jahren an die Spitze des Weltmarkts schraubten, scheiterte der deutsche Vorzeigekonzern bei den Handys: ein Vergleich der Innovationskonzepte und Managementstrategien.
Das Thema Innovation ist zentral für die Entwicklung von Siemens. Denn 75 Prozent der Siemens-Produkte sind erst fünf Jahre und jünger. Die Patentanmeldungen sind ein Indikator für die Innovationskraft: 2003/04 führte Siemens mit rund 4000 Patentanmeldungen in Deutschland, lag in Europa auf Platz zwei hinter Philips und rangierte bei den US-Patenterteilungen auf Platz sieben - hinter IBM und einigen japanischen Konzernen, aber weit vor dem Konkurrenten General Electric.
Aber nicht immer werden aus Innovationen und Patenten marktreife Produkte, geschweige denn Geschäftserfolge. Bekanntlich entwickelte eine Siemens-Tochter vor 30 Jahren das erste Faxgerät, das große Geschäft aber machten japanische Konzerne. Auch das unrühmliche Ende des Handy-Geschäfts von Siemens hängt mit Fehlern in der Innovationsstrategie zusammen.
Innovationen über Bereichsgrenzen hinweg
Sieben von elf Siemens-Geschäftsbereichen sind in ihren Märkten derzeit die Nummer eins oder zwei auf dem Weltmarkt. In der aktuellen Diskussion um Siemens geht diese Tatsache oft unter. So wird Siemens als Mischkonzern von den Kapitalmärkten derzeit mit einem Konglomeratsabschlag von zehn bis 20 Prozent bestraft. Das bedeutet: Für die Investoren sind die Einzelteile von Siemens mehr wert als der Konzern insgesamt. Trotz der Größe von Siemens ist das wegen der breit gestreuten Aktionärsstruktur gefährlich; für Private Equity- und Hedgefonds reicht eine Minderheitsposition für einen bestimmenden Einfluss.
Das Management muss also beweisen, dass Siemens - auch vom Börsenwert her - mehr ist als die Summe der einzelnen Geschäftsbereiche, damit die Forderungen nach einer Zerlegung des Konzerns nicht wieder laut werden wie schon vor Jahren. Es geht darum, die im Konzern schlummernden Synergien im operativen Geschäft, aber ebenso in der Forschung und Entwicklung zu heben.
Deshalb hat Siemens jetzt unter anderem unter dem Motto "Siemens ONE" ein konzernweites Programm gestartet mit dem Ziel, bei größeren Projekten - zum Beispiel beim Bau eines Sportstadions oder bei der Fußball-WM 2006 - die Angebote der verschiedenen Siemens-Bereiche, von der Beleuchtung über die Sicherheitstechnik bis zur Kommunikation, zu bündeln und zu optimieren. Außerdem verstärkt der Konzern die Entwicklung von bereichsübergreifenden sektoralen Innovationen, etwa in der drahtlosen Kommunikation, die auch die Steuerung von Prozessen oder die Leittechnik beeinflusst.
Wie in anderen Konzernen steht auch bei Siemens aktuell China im Fokus des Managements - nicht nur als Absatzmarkt, sondern auch als Heimat schnell wachsender, aggressiver Konkurrenten. Längst haben in der Telekommunikation die chinesischen Konzerne Huawei und ZTE Weltniveau erreicht, sind zur direkten Bedrohung von Siemens und Co. geworden und scheinen unschlagbar mit ihrem unerschöpflichen Reservoir an billigen, hoch qualifizierten und hoch motivierten Arbeitskräften und mit Kapital vom chinesischen Staat.
Es ist absehbar, dass chinesische Konzerne bald auch auf anderen Märkten und Branchen, beispielsweise im Kraftwerksgeschäft, in der Weltklasse mitspielen. Es ist also die Frage, mit welchem Geschäftsportfolio, mit welchen Produkten und Dienstleistungen, kurz mit welchen Innovationen das Unternehmen künftig der Konkurrenz aus China begegnen kann.
Vom Nachzügler zum Weltmarktführer
In den 90er Jahren geriet die Medizintechnik-Sparte von Siemens in eine schwere Krise. Schon damals garantierte der weltweite Markt für Medizintechnik dauerhaft hohe Wachstumsraten. Nur wenige Konzerne teilten sich das Geschäft mit der teuren Ausrüstung für Krankenhäuser und Praxen auf. Es war also keine Branchenkrise, die die Siemens-Sparte damals beutelte. Sondern Siemens hatte gegen die Konkurrenz vor allem von Philips und GE zu wenig wettbewerbsfähige Produkte und zu hohe Kostenstrukturen.
Mitte der 90er Jahre war das Geschäft so weit eingebrochen, dass der Ausstieg von Siemens aus der Medizintechnik offen diskutiert und von Börse und Analysten auch gefordert wurde. Die Konzernspitze stellte damals die gesamte Sparte mit allen Produkten auf den Prüfstand und entschied sich, aus der Dentaltechnik (Hauptstandort Bensheim mit 1000 Beschäftigten) komplett auszusteigen, aber das restliche Geschäft zu sanieren.
Auch für die bei Siemens verbleibenden Beschäftigten in Mittelfranken begann eine harte Zeit: Über 3000 Beschäftigte, meist Arbeiter, verloren ihren Arbeitsplatz, auch wenn es nur wenige betriebsbedingten Kündigungen gab. Als Gegenleistung für die massiven Investitionen in die neuen Entwicklungs- und Fertigungsstandorte in Erlangen und Forchheim verlangte der Konzern von der IG Metall und den Betriebsräten Zugeständnisse - bei Schichtzulagen, Überstundenbezahlung und Samstagsarbeit. In die Tarifverträge wurde nicht eingegriffen.
Der Konzern nahm die Sanierung der Sparte mit langem Atem und mit dem in den anderen Geschäften verdienten Geld in Angriff. Damit begann die Sparte eine erfolgreiche Aufholjagd: Sie trägt rund eine Milliarde Euro Gewinn zum Konzernergebnis bei und erzielt ständig zweistellige Gewinnmargen. Auf wichtigen Gebieten ist die Sparte Weltmarktführer.
Die Erfolgsfaktoren für den Turnaround: Siemens war mit bahnbrechenden Innovationen schnell am Markt, indem die Forschung (unter anderem die Zentralabteilung Corporate Technology in Princeton), die Entwicklung und die Produktion eng zusammenarbeiteten. Das verkürzte die Entwicklungszeiten, verringerte die Anlaufkosten in der Fertigung und beschleunigte die Innovationszyklen. Die Vernetzung zu Forschungseinrichtungen, zu Universitäten und Krankenhäusern lieferte die technologischen Voraussetzungen für neue Entwicklungen und sorgte dafür, dass die teuren Anlagen nicht an den Bedürfnissen der Kunden vorbei entwickelt wurden.
Die Medizintechnik zeigt außerdem, dass erfolgreiche Innovationen auch immer konkrete gesellschaftliche Voraussetzungen haben und nicht überall auf der Welt, in Indien oder Rumänien, genauso entstehen können. Ohne ein hoch entwickeltes, gesellschaftlich organisiertes und finanziertes Gesundheitswesen ist die moderne Medizintechnik nicht denkbar, gibt es beispielsweise keine Kernspin-Tomografie.
Kostensenken statt Innovation
Erst relativ spät, Mitte der 90er Jahre, als die heutigen Schwergewichte Nokia und Motorola ihre Claims im Handy-Geschäft schon abgesteckt hatten, hat sich Siemens entschieden, auch in diesem Markt mitzumischen. Dabei hatte Siemens wesentlichen Anteil an der Entwicklung des GSM-Mobilfunkstandards und war damit eigentlich prädestiniert für dieses Geschäft.
Dass der späte Markteintritt nicht unbedingt von Nachteil sein muss, haben asiatische Konzerne wie Samsung, LG oder BenQ bewiesen. Auch Siemens konnte in den folgenden Jahren schnell zur Nummer vier auf dem weltweiten Handy-Markt aufsteigen. Diese Marktposition und der damit verbundene hohe Cashflow boten eigentlich die Voraussetzung, das Handy-Geschäft nachhaltig zu stabilisieren. Was ist schief gelaufen, und was hat das mit Innovationen zu tun?
Siemens-Vorstandsmitglieder haben wiederholt erklärt: Siemens versteht das Endkunden-Geschäft nicht richtig, wir verstehen mehr vom Geschäft mit Großanlagen oder Infrastruktur. Derartige Äußerungen waren nicht gerade eine Einladung an die Mobilfunk-Provider, verstärkt Siemens-Handys zu ordern. Und diese Aussagen erklären bestenfalls einen Teil der Probleme im Handy-Geschäft.
Zweifellos ist der Handy-Markt heute einer der härtesten und sich am schnellsten wandelnden Technologiemärkte. Anfangs ein reinrassiger Markt für Geschäftskunden, ist dieser Markt heute hochgradig segmentiert - von Business-Accessoires, die Mailfunktionen integrieren (Blackberry) und in allen mobilen Netzen (GSM, UMTS, WiFi, WiMax) unterwegs sind, über kultige Modeartikel, die neueste Multimedia-Renner integrieren, bis zu Billigprodukten für das brasilianische oder hinterindische Dorf.
Um als weltweiter Handy-Lieferant mit dem passenden Produkt zur rechten Zeit auf dem richtigen Markt zu sein, ist erstens Kundenfokus und Marktforschung nötig, damit die Trends sofort erkannt werden. Zweitens sind schnelle Entscheidungswege und schlanke Strukturen von der Verwaltung und dem Einkauf über F&E bis zur Fertigung nötig. Drittens sind technische Voraussetzungen bei Software und Hardware erforderlich, um kurzfristig ganz neue Produkte auf den Markt zu bringen, und viertens muss das Unternehmen - allein oder mit Partnern - in allen für mobile Endgeräte potenziell relevanten Technologien Know-how haben oder aufbauen.
Das falsche Problem gelöst
Offensichtlich haperte es mit dem Verständnis, wohin sich die Märkte entwickeln, was die Kunden wollen oder welche Innovationen für viele Kunden künftig unverzichtbar sind. Obwohl die Siemens-Handy-Sparte zeitweilig in China, dem größten Handy-Markt der Erde, 15 Prozent Marktanteil hatte, verpasste sie die Entwicklung der Handys vom Reisebegleiter für Geschäftsleute zum begehrten Konsum- und Wegwerfartikel für jedermann.
Der chinesische Markt ging unter anderem verloren, weil Siemens die dort plötzlich begehrten Klapphandys nicht im Angebot hatte. Von der so genannten "Featuritis", die aus dem Handy einen Allzweckbegleiter mit Kamera, MP3-Player und Telefon und künftig TV-Gerät macht (weitere beliebige Kombinationen sind denkbar), wurde die Siemens-Sparte kalt erwischt. Hier ist das Eingeständnis, man verstehe das Endkundengeschäft nicht richtig, noch am ehesten am Platz. Denn die zusätzliche Funktionalität ist oft nicht mehr als Spielerei.
Zweitens unterblieben wichtige Prozessinnovationen: So wurden Tastaturen in München entwickelt und gestaltet, die Prototypen ein paar hundert Kilometer entfernt in Kamp-Lintfort gefertigt und dann wieder zurück nach München geschafft. Die für erfolgreiche Siemens-Bereiche so typische enge Verzahnung von Forschung, Produktentwicklung und Fertigungsanlauf (Ramp-up), die wesentlich zur Sicherung von Fertigungsstandorten in Deutschland beigetragen hat, wurde im Handy-Geschäft nicht konsequent umgesetzt.
Es gab also in der Entwicklung eines einzelnen Produkts zur Serienreife zu viele Schnittstellen, weil die Entwicklungskapazitäten für ein Projekt weltweit verteilt waren. Das Ergebnis waren zwangsläufig Fehler und zu lange Entwicklungszeiten, zu hoher Koordinationsaufwand. Die internen Prozesse von der Marktforschung über die Produktidee bis zur Serienreife waren nicht angemessen, zu langsam und zu komplex für das Geschäft, in dem Tempo und die pünktliche Einführung neuer Produkte über Erfolg oder Scheitern am Markt entscheiden.
Es kam wohl hinzu, dass in der Entwicklung zu lange optimiert wurde, der Ingenieursgeist sich austoben konnte. So war die Markteinführung eines neuen Siemens-Handys oft mehrere Monate später, als den Mobilfunk-Providern zugesagt war.
Es fehlte ferner eine Softwareplattform in Kombination mit einem leistungsfähigen, flexiblen Chipsatz, die es erlaubt hätte, in kurzer Zeit viele neue, verschiedene Produkte parallel zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Die auch aus der Autoindustrie bekannte Plattformstrategie verkürzt Entwicklungszeiten und -kosten dramatisch und ermöglicht schnelle Antworten auf ganz neue Kundengruppen und -anforderungen.
Schließlich hatte die Siemens-Handy-Sparte nicht in die technisch nächste Handy-Generation, die UMTS-Handys, investiert. Zwar stellte das Management die derzeitigen Marktchancen von UMTS-Handys zu Recht in Frage. Dennoch hatte sich die Siemens-Sparte damit von den technologischen Grundlagen zukünftiger Handy-Generationen verabschiedet und sich zum Lizenznehmer anderer Anbieter gemacht. Die Gewinne macht aber der Lizenzgeber, und nicht der Lizenznehmer.
Noch eine Anmerkung aus gewerkschaftlicher Sicht: Angesichts der genannten massiven Probleme der Sparte spätestens im Jahre 2004 hatten sich der Siemens-Vorstand und das Management der Handy-Sparte monatelang ausgerechnet auf das Thema Arbeitskosten und Arbeitszeiten in der Handy-Fertigung konzentriert. Die wirklichen Probleme, die Innovationsthemen, blieben ungelöst - und das bei einem Lohnkostenanteil in der Handy-Fertigung in Deutschland um fünf Prozent und in Shanghai von 3,8 Prozent. Siemens hat gegen die Beschäftigten und die IG Metall also das falsche Problem gelöst.
F&E bei Siemens
Siemens ist neben SAP der deutsche High Tech-Vorzeige-Konzern. Der Konzern beschäftigt weltweit über 45000 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung, davon zirka 25000 in Deutschland. Dazu gehören die F&E-Aktivitäten der Siemens-Geschäftsbereiche wie auch die zentralen Forschungsaktivitäten, die in der Einheit Corporate Technology CT mit Standorten in München, Erlangen, Berlin, Princeton (USA) und Beijing gebündelt sind.
Auch die verstärkte Verlagerung (Offshoring) von IT- und F&E-Aktivitäten an Billigstandorte in Mittel- und Osteuropa und vor allem nach Indien und China haben an der Bedeutung der deutschen F&E-Standorte bislang nichts geändert.