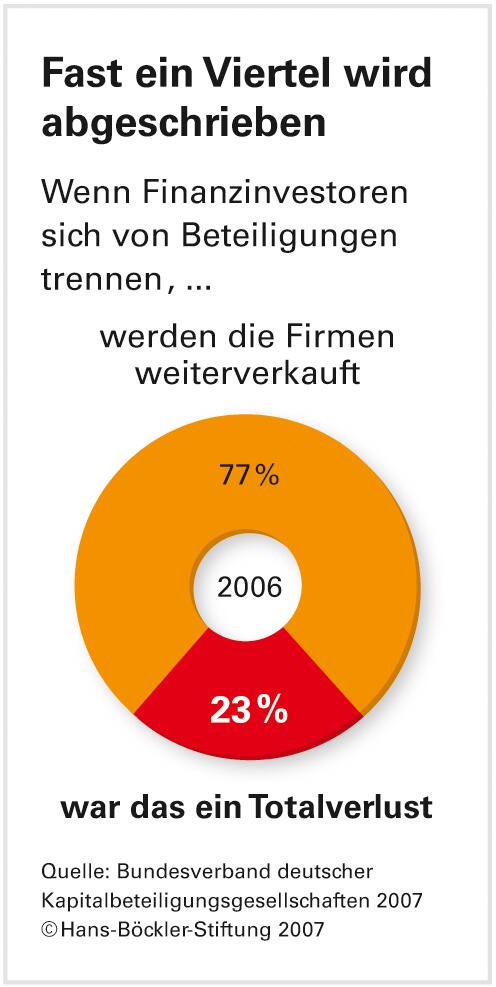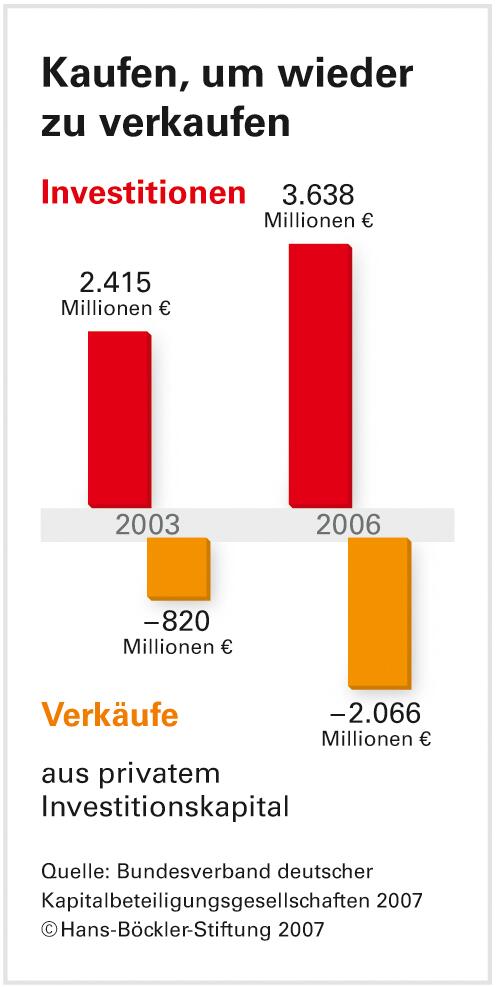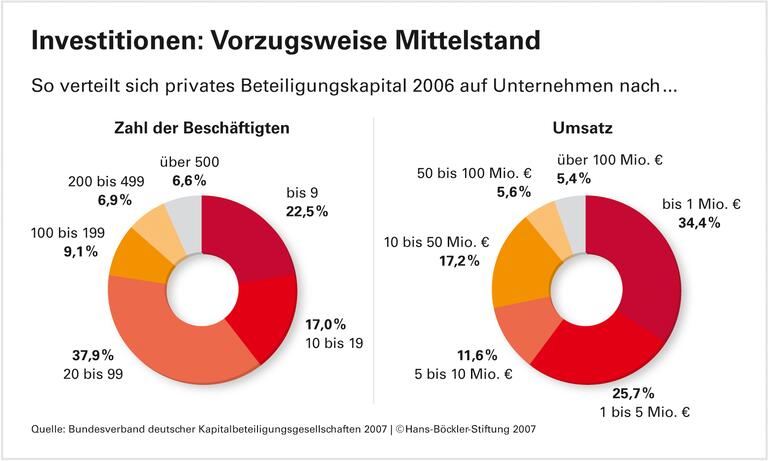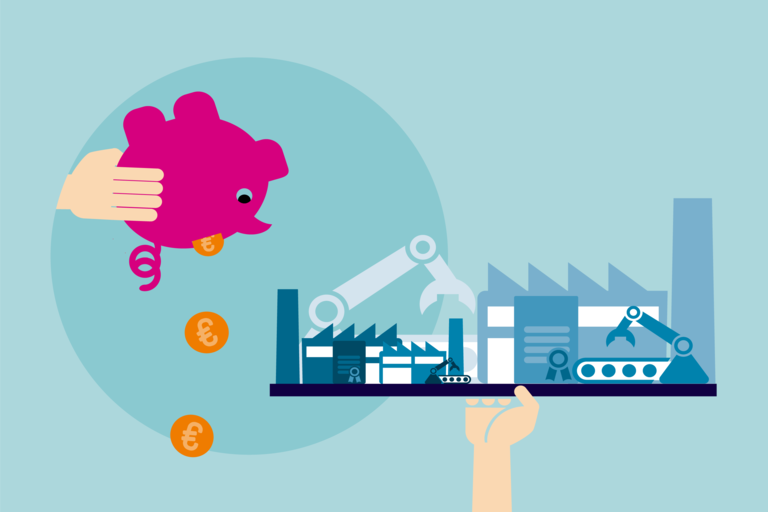Finanzinvestoren: Vorzug für Anleger mit Perspektiven
Aggressive Anleger drängen auf hohe Ausschüttungen, selbst wenn sich Unternehmen darüber völlig verschulden. Ein Gutachten skizziert, wie Regulierung dies eindämmen kann: durch qualifizierte Stimmrechte und Grenzen für den Rückkauf von Aktien.
Möglichst rasch Geld aus einem Unternehmen ziehen - das streben viele Private-Equity- und Hedge-Fonds an, wenn sie Firmen übernehmen. Die gleiche Absicht verfolgen auch einige Anleger, die zwar nur kleinere Aktienpakete an Unternehmen erwerben, aber dennoch versuchen, großen Einfluss auf das Management auszuüben. Dazu nutzen sie Koalitionen mit anderen Aktionären und öffentlichen Druck. Hans-Joachim Voth, Experte für Finanzmärkte, analysiert in einem Gutachten für die Hans-Böckler-Stiftung den so genannten Investoren-Aktivismus - welche Schäden er verursacht und wie er reguliert werden kann. Investoren-Aktivisten waren bei Unternehmen wie General Motors, der Deutschen Börse und ABN Amro erfolgreich. Sie drängen auf Sonderdividende und Aktienrückkäufe, um den Kurs der Aktie zu erhöhen. Um das zu bezahlen, verlangen sie vom Management den Abbau von Barreserven, den Verzicht auf Investitionen, den Verkauf von Unternehmensteilen - eine Unternehmenspolitik, die Beschäftigten, Zulieferern und Gläubigern schadet.
"Für Aktionäre kann das finanzielle Ausbluten von Unternehmen profitabel werden", beobachtet der Ökonomie-Professor mit Lehrstuhl in Barcelona. Selbst große Unternehmen wie General Motors (GM) werden zum Opfer des Investoren-Aktivismus. Bei GM gab es in den 90er-Jahren einen Aufstand der Aktionäre - angeführt vom berühmt-aktivistischen Rentenfonds der kalifornischen öffentlichen Angestellten CalPERS. In der Folge wurden der Vorstandsvorsitzende entlassen, ein radikales Schlankheitsprogramm verordnet, Milliarden an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Konsequenz für den Autobauer: "Mittlerweile ist die Produktpalette so veraltet, dass GM die Krankenversicherungs- und Pensionskosten seiner Arbeiter kaum noch zu tragen vermag."
Um weiteren Raubbau an Industrieunternehmen durch allein kurzfristig orientierte Anleger zu verhindern, empfiehlt der Finanzmarktexperte gesetzliche Regulierung.
Qualifizierte Stimmrechte. Der Wirtschaftswissenschaftler hält es für fraglich, ob kurzfristig erworbene Aktien mit vollen Stimmrechten ausgestattet sein sollten. Etliche Investoren-Aktivisten reklamieren für sich, Verfechter einer Anlegerdemokratie zu sein. "Doch niemand würde auf die Idee kommen, in der Schweiz alle Touristen abstimmen zu lassen", erwidert Voth. Schon einfache Regeln können für Verbesserungen sorgen: "Würde beispielsweise eine Mindesthaltedauer von einem Jahr zwingend vorgeschrieben, bevor Aktienstimmrechte auf der Hauptversammlung ausgeübt werden können, so würden die Gewinnaussichten für kurzfristig agierende Investoren deutlich zurückgehen." Eingriffe von Investoren ohne Interesse am langfristigen Unternehmenserfolg lassen sich so eindämmen. Nach einer Haltedauer von drei Jahren könnte das Stimmgewicht verdoppelt werden.
Mehr Transparenz. In den USA müssen alle Anleger, die mehr als fünf Prozent einer Aktiengesellschaft besitzen, detailliert Auskunft über Geldgeber, ihre Intentionen und Handelsverhalten geben. Wie viele Anteile haben sie, wem gehört der Fonds, welchen persönlichen Hintergrund hat der Großaktionär, ist er in Rechtsstreitigkeiten verwickelt? Das vermeidet Insiderkonflikte und gibt dem Unternehmen die Chance, sich auf seine Eigentümer einzustellen. Sollte es hierfür keinen europäischen Konsens geben, "wäre sogar ein deutscher Alleingang möglich und hilfreich", erklärt der Finanzexperte. Wer sich als Aktionärsdemokrat versteht, dürfte gegen eine solche Auflage keine Einwände haben.
Grenze für Aktienrückkäufe. In den USA setzten die Unternehmen zwischen 2000 und 2005 jeden zweiten neu geliehenen Dollar nicht für Investitionen ein, sondern dafür, an der Börse Aktien des eigenen Unternehmens zu kaufen. Das Kalkül hinter einem Großteil dieser Transaktionen: Es kursieren weniger Aktien am Kapitalmarkt, darum fällt der Gewinn je Aktie höher aus - selbst bei unverändertem Gewinn. Die ausgewiesene Eigenkapitalrendite steigt also. Doch der Rückkauf hat auch Nachteile: Das Unternehmen wird anfälliger für Krisen, und das bei wachsender Verschuldung. Weniger risikotragendes Kapital steht zwischen der Firma und der Insolvenz, sollten die Verkäufe mal einbrechen. Die Interessen von Investoren und anderen Stakeholdern - wie Beschäftigten und Zulieferern - driften auseinander. Dazu Voth: "Investoren können durch Diversifikation mit dem Risiko einzelner Pleiten leben - Angestellte nicht." Um die Ungleichheit wenigstens einzuschränken, schlägt der Finanzfachmann vor, den Rückkauf von mehr als 5 Prozent aller ausstehenden Aktien pro Jahr gesetzlich zu verhindern. Bei einer solchen Schranke - die derzeit bei 10 Prozent liegt - könne das Management immer noch den Eigenkapital-Einsatz steuern. "Doch der Hoffnung auf schnelle Kurssteigerungen, indem Barreserven oder frische Schulden für Rückkäufe eingesetzt werden, wäre so ein Riegel vorgeschoben." Dafür könnten dickere Kapitalpolster die Firmen und die Volkswirtschaft abfedern.
Schranken für Schuldenaufnahme. Werden die Rückkauf-Möglichkeiten beschnitten, dann können die Investoren-Aktivisten Ausschüttungen auf einem anderen Weg anstreben - etwa via Sonderdividenden. Wenn das Unternehmen nicht über umfangreiche Barreserven verfügt, haben aggressive Anteilseigner in der Vergangenheit neue Kredite für die Dividendenzahlung verlangt. Will der Staat das einschränken, kann er gegen eine zu hohe Verschuldung vorgehen, so der Wissenschaftler. Ein erster Schritt dafür ist getan: Die Zinsschranke der novellierten Unternehmensteuer begrenzt die steuerliche Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen. Ein zweiter, noch wichtigerer Ansatz zielt auf den Schutz der Altgläubiger des Unternehmens. Denn Anleihenbesitzer und Banken geben Unternehmen Geld in der Annahme, dass es weiter solide wirtschaftet. Rückt das Unternehmen auf Druck der Investoren-Aktivisten vom Kurs ab, werden faktisch Mittel umverteilt, analysiert der Ökonom. Zu Gunsten der Aktionäre stehen die Gläubiger schlechter da. Voths Vorschlag: "Wenn der ursprüngliche Kreditvertrag keine Klauseln für den Fall einer Bonitätsminderung vorsieht, sollte die Möglichkeit der Schaffung von Regressansprüchen geprüft werden."
Hohe Ausschüttungen schwächen die Perspektiven der Firma. Zwar argumentieren manche Betriebswirte, es sei besser, wenn ein Unternehmen nicht über allzu viel Geld verfügt; das verführe das Management, in Projekte mit schlechten Aussichten zu investieren. Doch diese These wird nicht von der Empirie gestützt, wie Voth darlegt. Eine Untersuchung zweier US-Forscher zeigt vielmehr: Firmen, die über viel Bargeld verfügen "schneiden deutlich besser in ihrem operativen Geschäft ab als Konkurrenten aus der gleichen Industrie und mit vergleichbarer Größe sowie diejenigen Firmen, die ihre Barreserven massiv reduziert haben". Sie investieren mehr als andere, wachsen schneller, forschen und entwickeln mit mehr Nachdruck.
Die Budgets für Forschung und Entwicklung (F&E) werden regelmäßig beschnitten, wenn ein Aktionär massive Ausschüttungen durchsetzt. Für die USA hat eine Studie des U.S. Census Office nachgewiesen, dass Firmen mit hohen Barbeständen rund 17 Prozent ihrer Aktiva für F&E verwenden. Die Konkurrenten, denen es an Liquidität fehlt, setzen nur etwa die Hälfte davon ein. Das deutet darauf hin, dass Investitionen mit Fremdkapital schwerer zu realisieren sind. Untersuchungen belegen auch: Nach Übernahmen durch Private-Equity-Fonds sinken in der Regel die Forschungsausgaben. Besonders auffällig ist das, wenn der Kaufpreis per Kredit finanziert wurde: Laut einer weiteren Studie des U.S. Census Office kommt dann eine Kürzung um 40 Prozent. Bei kleineren Firmen schlägt sich das zügig auf den Markterfolg nieder. Voth folgert daraus, "dass bei der Ausschüttung der Barreserven an die Aktionäre den Firmen häufig ein Stück ihrer Zukunft geraubt wird". So entstünden erhebliche Schäden für die Volkswirtschaft.
Bereits 1989 beklagte der renommierte Wachstumstheoretiker und Nobelpreisträger Robert Solow den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit vieler US-Firmen durch eine "exzessive und gefährliche Überschätzung der Kurzfrist-Profitabilität". Diese von Investoren-Aktivisten durchgesetzte Denkweise hatte Folgen für die angelsächsische Wirtschaft, ergänzt Hans-Joachim Voth. "Nachdem in den USA und auch in Großbritannien der Industriesektor in den letzten Jahren massiv geschrumpft ist - auch wegen der Aktivitäten von PE-Firmen -, droht ein ähnliches Schicksal in Europa."
Hans-Joachim Voth: Transparenz und Fairness auf einem Einheitlichen Europäischen Kapitalmarkt, Gutachten für die Hans-Böckler-Stiftung, Mai 2007
Download (pdf)