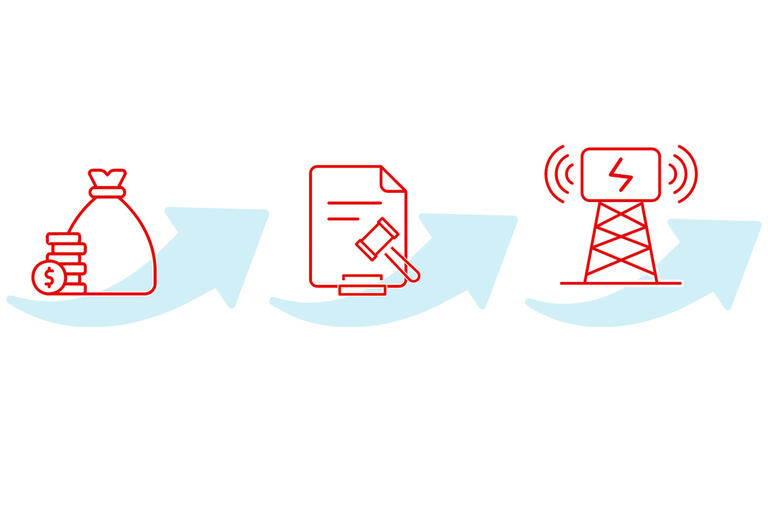: Wir, die Überflüssigen
15 Jahre nach der Wende haben die ehemaligen DDR-Arbeiter begriffen, dass der moderne Kapitalismus sie nicht braucht. Manche flüchten in das Private, andere erproben neue Formen der Aufmüpfigkeit. Ein Bericht aus Leipzig
Von Hendrik Ankenbrand
Der Autor arbeitet als freier Journalist in Köln.
Es ist ruhig hier, und sehr einsam. Kaum ein Lebenszeichen zwischen sanierter und unsanierter Platte, kündeten nicht die blank gewienerten, in Reih und Glied geparkten Opel und Ford von ihren Besitzern. Parkplätze und Menschen, beides ist Mangelware an diesem Dienstagvormittag in Leipzig-Grünau. Wo stecken die Einwohner der drittgrößten Plattenbausiedlung Ostdeutschlands, der einstigen Wohnoase für Facharbeiter im Dienste des Sozialismus? Im Kondi-Discount? In der neuen Schwimmhalle? Auf der Arbeit?
"Kommse mal um Zweie wieder", rät eine ältere Dame auf die Frage nach ihren Mitmenschen, "dann hammse ausgepennt." Jene Menschen, die man in Grünau nicht zu Gesicht bekommt und doch dort wohnen sollen, bezeichnen Michael Hofmann und Dieter Rink als "traditionsbewusste Arbeiterschaft". Seit der Wende gehen die beiden Leipziger Soziologen der Frage nach, wohin die ostdeutsche Arbeiterschaft entschwindet. Grundlegende Erkenntnis: "Die" Arbeiter gibt es nicht.
Das Milieu teilt sich grob in zwei grobe Schichten. Die in der DDR gut ausgebildeten Facharbeiter, die nach alter Sitte den Beruf des Vaters und Großvaters ergriffen, sind die "Traditionsbewussten". Meist leben sie noch immer in der Platte. Die "Traditionslosen" stellten die zweite Schicht im Arbeitermilieu der DDR. Es waren jene, die in den Braunkohlefabriken und Chemiekombinaten die Drecksarbeit erledigten, die einfachen Arbeiter, zum Teil über mehrere Generationen.
Wer sie sucht, der fährt am besten nach Plagwitz, weil hier deren Heimat ist. Oder war. Plagwitz ist ganz anders als Grünau, obwohl zwischen den beiden Leipziger Vierteln nur wenige Kilometer liegen. Dieser Platz hat einen Ruf wie Donnerhall bis weit über Leipzigs Grenzen hinaus. Ein traditionelles Arbeiterviertel, mit Strukturen, die in mehr als einem Jahrhundert gewachsen sind; noch zu DDR-Zeiten ein Wirtschaftsstandort mit 20 000 Arbeitsplätzen im Metallbau und in der Chemie. Kurzum: das industrielle Herz der Stadt.
Die Fabriken aus der Gründerzeit verfallen
Riesige, verfallene Fabrikanlagen aus der Gründerzeit erinnern an die vergangene Größe, dazwischen klemmen die Altbauten mit den Arbeiterwohnungen. Ein echtes Malocherquartier, damals jedenfalls, als die Schornsteine noch qualmten. Viel Wohnraum ist saniert, der Rest steht leer. Künstler sind in die schönen neuen Ateliers gezogen, es gibt ein schickes Existenzgründerzentrum. Die Arbeiter sind nun in der Minderheit. Das industrielle Herz, es schlägt schon längst nicht mehr.
Das Arbeiterviertel Plagwitz und sein Verfall nach der Wende stehen für das Abdriften eines ganzen gesellschaftlichen Milieus. Nirgendwo sonst wird dies so deutlich wie auf dem Jahrtausendfeld, einer riesigen freien Fläche auf dem ehemaligen Werksgelände der Bodenbearbeitungsgerätefabrik BBG. Künstler haben eine gigantische Lücke in die Fabrikmauern geschlagen, hinter denen einmal 4000 Menschen Arbeit fanden. Wo früher Landmaschinen montiert wurden, prangt nun ein symbolisches Ackerfeld, umrandet von verfallenen Industrieruinen. Das Kunstprojekt soll den Strukturwandel symbolisieren, Mut machen.
Auf diesem Boden könnte eine neue, andere Zukunft gedeihen, soll das Feld den Arbeitslosen bedeuten, die hier den Hund ausführen. Doch die sehen vor allem Brachland. Deindustrialisierung, das heißt, dass der Raum seine Funktion verliert, und die Arbeiter die ihre. Sie müssen von Almosen und mit täglichen Kränkungen fernab des ersten Arbeitsmarkts leben. Das ist es, was gerade die "Traditionslosen" aufmüpfig macht, was sie zu den Demonstrationen treibt oder zu Protestparteien.
Ostdeutschland, sagt Michael Hofmann, Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung, sei heute eine "nach-arbeiterliche Gesellschaft", in der die Arbeiter weitgehend unsichtbar geworden seien. Das Kumpelhaft-Kollegiale des Alltags, das die DDR-Gesellschaft so stark geprägt hat, ist mit den Betriebsschließungen verloren gegangen. Die Arbeiterquartiere sind unsaniert und stehen leer; oder sie sind aufgewertet wie in Plagwitz, um neue zahlungskräftigere Mieter anzulocken.
In den Zeitungen kommen allenfalls Erfolgsgeschichten zur Geltung - Zeiss in Jena oder die BMW- und Porsche-Werke in Leipzig, wo etwa 5000 Arbeitsplätze entstanden sind. Zu wenig, um die Arbeiterschaft wieder ins öffentliche Bewusstsein zurückzuholen. Herausziehen aus dem Schlund, in den sie nach der Wende gestürzt ist. Ein Sturz aus gesellschaftlichen Höhen.
"Niemand in der DDR war so frei wie die Arbeiter", sagt Dieter Rink. In den Kombinaten hatten sich die Facharbeiter gut eingerichtet. Nach dem Aufstand von 1953 gegen die Erhöhung der Normen habe sich die SED gehütet, die Industriearbeiter allzu sehr unter Druck zu setzen. Die Löhne stiegen. Innerbetrieblich seien die Arbeiter fortan in einer relativ starken Position und hätten einen Burgfrieden mit dem "Schauspielerensemble" abgeschlossen, als das die Werksleitung verhöhnt wurde: Halten wir still, lasst ihr uns in Ruhe. Nach Feierabend ging die Brigade gemeinsam Trinken, das Leben war so schlecht nicht.
Dass gar nichts gut war, mussten die hochqualifizierten Facharbeiter aber spätestens in den 80er Jahren erkennen. Niemand hatte den wirtschaftlichen Verfall der DDR täglich so intensiv vor Augen wie sie. In den Betrieben verrotteten die Maschinen, die Arbeits- und Lebensbedingungen verschlechterten sich dramatisch, die Produktion war ein Trauerspiel. Und heute? "Hast du noch richtige Arbeit oder bist du in so einer Maßnahme?" - das ist eine gängige Frage im Freundeskreis.
Kern des gesellschaftlichen Fortschritts seien die Arbeiter, hatten diese bei Marx gelesen. Nur um nach der Wende fassungslos feststellen zu müssen, dass dieser Kern im modernen Kapitalismus der Profit ist. Dass dieser gerade dann steigt, wenn Arbeiter entlassen werden, diesen Zynismus der Börse können und wollen sie bis heute nicht begreifen.
In den Familien rissen schon zu DDR-Zeiten die jahrzehntelang gewachsenen Traditionslinien. In den Arbeiterquartieren im Zentrum verfielen die Häuser, das "traditionslose" Milieu wuchs, unterstützt durch die hohe Binnenmobilität in der DDR. Je steiler die Talfahrt der DDR-Wirtschaft, desto stärker wuchs bei der Arbeiterschaft das Verlangen, endlich auch ein Stück vom Wohlstand zu ergattern, der täglich im Westfernsehen zu bestaunen war.
"Die Arbeiter sind die wahren Protagonisten der Wendezeit gewesen", sagt Michael Hofmann. Denn sie seies es gewesen, die die Ausreiseanträge stellten, die den Druck auf das System erhöhten. Tatsächlich priesen viele Sprechchöre der Wendezeit die D-Mark, nicht die Demokratie. "Helmut nimm uns an die Hand und führ uns ins Wirtschaftswunderland!", stand 1990 auf den Transparenten an der Leipziger Nikolaikirche. Nicht alle, die hier demonstrierten, dachten an Meinungsfreiheit - viele wollten einfach nur ordentliche Autos fahren.
Ein sanierter Plattenbau, ein Opel Astra
Das neue Auto haben sie bekommen. In Grünau steht es vor der sanierten Plattenbauwohnung, in der nun nicht mehr der Wind durch die Papptür pfeift und der Quadratmeter trotzdem nur 4,11 Euro kostet. Wolfgang Hinse, 47, fährt einen Opel Astra, Baujahr 2001, und hat es sich auf 70 Quadratmetern gemütlich gemacht - allein, nachdem ihn seine Frau verlassen hat. 1985 ist er hergezogen, da war er Ingenieur für Standardisierung, er ist dageblieben, als die Kollegen 1989 in den Westen gemacht haben, und zog auch nicht fort, als er kurz nach der Wende seine Stelle verlor.
Hinse mag es hier, weil der Supermarkt nah und der Blick aus dem Fenster weit und unverstellt ist. Es ist sein Stück Heimat, sein Rückzugsort. Fragt man ihn, ob es ihm heute besser gehe als vor zwanzig Jahren in der DDR, antwortet er: "Auf jeden Fall." Das schöne Auto, die sanierte Wohnung, die saubere Luft. Ob er sich als Gewinner oder Verlierer der Einheit sieht? "Als Verlierer, eindeutig."
Das ist der Widerspruch, den viele hier aushalten müssen. Mag es ihnen materiell auch besser gehen, ihre hohe soziale Stellung haben sie mit dem Verlust ihrer Jobs ein für allemal eingebüßt. Eine Möglichkeit, damit klarzukommen, ist der Rückzug ins Private. Besonders die ehemaligen Facharbeiter sind verbittert. Ohne gesellschaftliche Hoffnungen suchen sie ein sparsames Glück und verschwinden aus der gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Auch im Westen gibt es diese Tendenz.
"Deklassierung" nennen Soziologen den Prozess
Tagtäglich verdichtet sich die Erfahrung, dass Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Ein-Euro-Jobs nicht zur Wiedereingliederung sondern zur Verdrängung aus dem Erwerbsleben führen. "Deklassierung" nennen die Soziologen den Prozess. Daraus entsteht eine Perspektivlosigkeit, die eine Geisteshaltung komplett verändern kann. Sie gipfelt in der Erkenntnis: Wir sind die Überflüssigen.
So falsch liegen die Arbeitslosen da wohl nicht. Wenn die Politik sie mit Hartz IV und Arbeitslosengeld II in die Sozialhilfe verdammt, dann vermitteln die Parteien ihnen das Gefühl, sie bereits abgeschrieben zu haben - besonders sie, die Ostdeutschen. Hartnäckig hielt sich auf den Montagsdemonstrationen das Gerücht, Sozialhilfeempfänger würden bei Hartz IV deshalb besser gestellt als Langzeitarbeitslose, weil die Profiteure davon mehrheitlich im Westen, die Verlierer eher im Osten zu finden seien.
Die etablierten Parteien haben in diesem Milieu oft keine Chancen mehr. "SPD=Sklavenhalter-Partei Deutschlands" stand auf den Transparenten der Montagsdemonstrationen. Es war vor allem der Hass der "Traditionslosen", der sich da zeigte. Hass auf Schröder, weil ihnen mit Hartz IV nun droht, endgültig den Anschluss zu verlieren. Und weil das kaum jemanden zu kümmern scheint.
Auch nicht die PDS. Könnte diese Partei, die in den neuen Bundesländern so viel Zulauf hat, nicht ein Schlüssel zum Verständnis des Ostens sein? Organisiert sie die Frustrierten und Enttäuschten? Wer die Altsozialisten als ostdeutsche Arbeiterpartei begreife, der komme wahrscheinlich aus dem Westen, vermutet Michael Hofmann.
Trotz der 25 Prozent, die die neue Linkspartei bei der vergangenen Bundestagswahl in den neuen Ländern geholt hat, ist er sich sicher: "Die ostdeutschen Arbeitslosen haben die noch nie gewählt und tun es jetzt auch nicht." Seiner Diagnose nach werde die PDS gerade von den Arbeitern als konservativ und als "Verteidigerin des DDR-Establishments" wahrgenommen.
Zum Establishment werden auch die Gewerkschaften gezählt. Ihr Ansehensverlust nahm mit den Schließungen ostdeutscher Industriestandorte wie Bischofferode seinen Abwärtslauf und erreichte mit dem Streikdebakel der Metaller im Jahr 2003 ("Im Osten geht die Sonne auf") einen Tiefstand. Schon vorher war die Tarifbindung im Osten eher schwach. Wer so deutlich an der Lebenswirklichkeit der Ostdeutschen vorbeiagiere, von dem dürfe man endgültig nichts mehr erwarten, lautete die einhellige Meinung nach dem Streik.
Weil die Politik nun zunehmend auch noch die Wahlenthaltungen ignoriert, bleibt den Arbeitslosen nur noch eine Chance, auf sich aufmerksam zu machen: extremistische Parteien. Hofmann und Rink warnen vor den Rechten hin, die durch die Stadtviertel marschieren und nun auch im schwarzen Anzug in zwei ostdeutschen Landtagen sitzen. "Die Rechten haben im Osten ein Protestpotential so hoch wie es die Grünen Anfang der 80er im Westen hatten", schätzt Michael Hofmann. Sie locken mit einer verführerischen Mischung aus neuem Nationalismus und alten sozialistischen Parolen. Besonders den Jüngeren gefällt das. "Der Rechtsradikalismus ist die einzige dominante Jugendkultur, die in den neuen Ländern flächendeckend vertreten ist", sagt Rink.
Aus den Erfahrungen mit der DDR und der Bundesrepublik basteln sich die Unzufriedenen ein Wunschgebilde zusammen, "eine Art DDR mit D-Mark", wie Dieter Rink es nennt. Wenn Arbeiter in der Öffentlichkeit auftauchen, dann sieht das heute oft so aus wie am Plagwitzer Karl-Heine-Kanal, oder auch in Grünau, jetzt um zwei Uhr mittags, wo ganze Familien durch die begrünten Seitenstreifen stapfen. Sie tragen Anoraks und halten lange Eisenzangen in den Händen.
Manche ziehen kleine Wagen hinter sich her, einer hat seinen Hund dran angeleint. Es sind Ein-Euro-Jobber, die den Müll einsammeln. In den Arbeitslosenzahlen tauchen sie nicht mehr auf. Und man könnte sagen, dass die ostdeutschen Arbeiter damit endgültig unsichtbar geworden sind. Jetzt, wo nicht einmal mehr die Statistik etwas von ihnen wissen will.
Zum Weiterlesen
Eine Studie von Michael Hofmann und Dieter Rink
über Arbeitnehmermilieus in Ostdeutschland erscheint demnächst in: Helmut Bremer/Andreas Lange-Vester (Hg.): Soziale Milieus und Wandel der Sozialstruktur. Wiesbaden, Verlag für Sozialwissenschaft (zum 65. Geburtstag von Michael Vester)