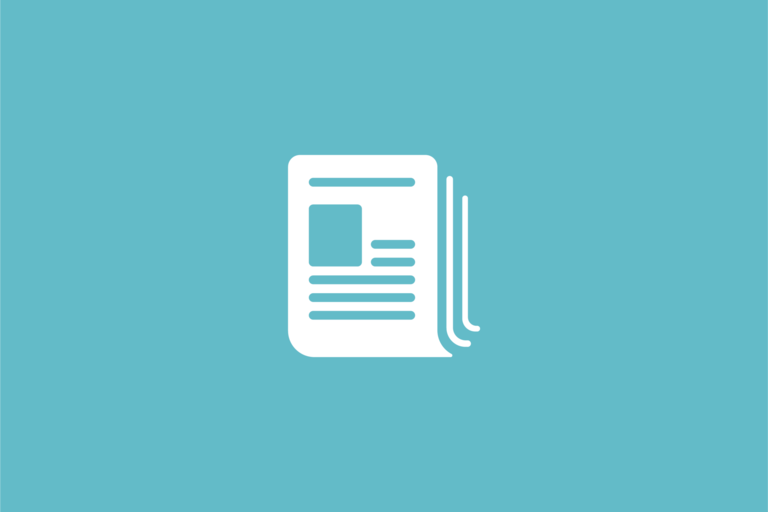: Neue Generationskonflikte
Die junge Generation zahlt Rentenbeiträge in Rekordhöhe und hat dennoch wenig zu erwarten. Aber die Konflikte in einer alternden Gesellschaft sind vielfältiger. Wird Kindermangel die traditionellen Familienwerte wieder aufwerten? Machen Kinder glücklicher?
Von Martin Höpner
Dr. Höpner ist Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kölner Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. mh@mpifg.de
Die hohe Anzahl zu versorgender Rentner ist gewissermaßen eine Spätfolge des demografischen Wandels. Die Gesellschaft wird die Probleme früher zu spüren bekommen. Das zeigen James W. Vaupel und Elke Loichinger vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock in Ausgabe 1/2006 von "Demografische Forschung aus erster Hand". Die Menschen werden älter, die Geburtenraten sinken, und die geburtenstarken Jahrgänge der 50er und 60er Jahre schieben sich Richtung Verrentung.
Doch die von ihnen geleisteten Arbeitsstunden werden zurückgehen, bevor das gesetzliche Rentenalter erreicht ist. In Deutschland arbeiten die 60- bis 65-Jährigen, vor allem aufgrund von Frühverrentungen, nur noch durchschnittlich acht Stunden pro Woche. Erreichen die heute zwischen 40 und 50 Jahre alten "Babyboomer" diese Altersstufe, wird sich das Verhältnis von tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und zu versorgenden Jungen und Alten verschieben.
Allein demografiebedingt werden - unter Annahme gleich bleibender Erwerbsneigungen der Altersstufen - die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden zwischen 2005 und 2025 in den USA um 4,1 Prozent zurückgehen, in Großbritannien um 5,0 Prozent, in Frankreich um 8,4 Prozent, in Deutschland sogar um 10,1 Prozent. Vaupel und Loichinger folgern: Die Verteilung der Arbeit über die Altersgruppen muss dringend überdacht und umorganisiert werden. Im Prinzip könnten die jüngeren Erwerbstätigen die sinkende Erwerbsneigung der Babyboomer durch Mehrarbeit ausgleichen. Aber diese Jahrgänge sind schwächer besetzt, ihre Arbeitsstunden müssten überproportional steigen. Vor allem aber müssten die 20- bis 40-Jährigen doch eigentlich entlastet werden, um die Gründung von mehr - und größeren - Familien zu ermöglichen.
Die Generationen haben komplett andere Interessen
Die Rostocker Studie verdeutlicht: Eine Lösung der durch die demografischen Verschiebungen ausgelösten Probleme wird nicht in Harmonie und Wohlgefallen zu machen sein. Die Generationen haben unterschiedliche Interessen. Förderung junger Familien oder Besitzstandswahrung der Alten? Die Problemlösungen der einen werden zu Problemen der anderen. Wie dieser Konflikt entschieden wird, wird nicht zuletzt von Machtressourcen und Wählermacht der Interessenträger abhängen. Wir wissen nicht, wer sich durchsetzen wird, aber eines steht fest: Die Alterung der Gesellschaft wird das politische Gewicht in Richtung der Älteren verschieben. Denn die Älteren werden eine (noch) wichtigere Wählergruppe als heute.
Mehr noch: Ältere nehmen häufiger an Wahlen teil als Jüngere und werden also politisch tendenziell überrepräsentiert. Diesen Effekt untersucht Achim Goerres von der London School of Economics in einer gerade erscheinenden Ausgabe des "British Journal of Politics and International Relations" anhand von Umfragedaten aus 21 Ländern. Zwar vereinigen Ältere eine Reihe von Merkmalen auf sich, die der Beteiligung an Wahlen eigentlich entgegenwirken: Sie haben in ihrer Jugend im Schnitt weniger Bildung genossen; im Vergleich zu Berufstätigen haben sie ein niedrigeres Einkommen; sie haben häufiger gesundheitliche Probleme und das zur Wahl ermunternde soziale Umfeld ist geringer ausgeprägt als bei Jüngeren.
Aber Effekte, die zu hoher Wahlbeteiligung der Rentner führen, überwiegen: Denn mit zunehmendem Alter empfinden Bürger die Beteiligung an Wahlen als soziale Pflicht. Die Identifikation mit dem politischen Gemeinwesen steigt mit der Dauer, die man an ein und demselben Wohnort verbracht hat. Zudem sind politisches Interesse und Identifikation mit Parteien und Großorganisationen bei Älteren überdurchschnittlich ausgeprägt.
Und wen wählen die Älteren? Bemerkenswert ist, dass Rentnerparteien wie die "Grauen" in Deutschland bisher nur geringe Erfolge für sich verbuchen konnten. Nur in den Niederlanden, Slowenien, Finnland und Luxemburg gelang es solchen Parteien vorübergehend, Ergebnisse von mehr als drei Prozent der abgegebenen Stimmen einzufahren. Allerdings will Goerres nicht ausschließen, dass solche Parteien mit zunehmender Alterung der Bevölkerung - und an Brisanz gewinnenden Verteilungskonflikten - tatsächlich wachsen könnten.
Wird die älter gewordene Brandt-Generation die SPD stärken?
Länderübergreifend gilt: Ältere Wähler bevorzugen den Status quo gegenüber Veränderungen und wählen überdurchschnittlich konservativ. Allerdings, so zeigt Goerres, ist der Sachverhalt etwas komplizierter, gleichzeitig aber auch interessanter. Denn zwei unterschiedliche Effekte überlagern sich: Alters- und Kohorteneffekte. Der Alterseffekt besagt: Je älter der Wähler, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Stimme an konservative Parteien fällt. Der Kohorteneffekt besagt: Wähler werden im Alter zwischen 15 und 30 Jahren politisch sozialisiert und bleiben den in dieser Phase erworbenen Parteipräferenzen mit gewisser Wahrscheinlichkeit treu.
Noch in den 50er Jahren wählte die deutsche Rentnerkohorte überdurchschnittlich sozialdemokratisch. Die heutigen Rentner wurden in der Adenauer-Ära politisiert. Aus diesem Grund wirkt neben dem Alterseffekt auch der Kohorteneffekt heute in Richtung CDU/CSU. Geht die "Brandt-Generation" in Rente, wird die SPD unter den Alten wieder etwas mehr an Boden gewinnen. Wie auch immer: Die politischen Parteien werden den Älteren im Kampf um Wählerstimmen attraktive Angebote machen müssen.
Politische Angst vor der Missgunst der Rentner ist bereits heute ausgeprägt. Erinnern wir uns an einen Vorgang aus dem März vergangenen Jahres. Die Bundesregierung hatte gerade den Armutsbericht 2005 vorgestellt. Er besagte, dass heute weniger hohes Alter als vielmehr Kinderreichtum Armutsrisiko Nummer eins ist. Der damalige Vorsitzende der Jungen Liberalen, Jan Dittrich, kommentierte den Armutsbericht wie folgt: "Es wird Zeit, dass die Alten von ihrem Tafelsilber etwas abgeben - einen Löffel, oder besser gleich ein paar davon
Es ist an der Zeit, die Lasten endlich gerecht zu verteilen." Ekelhaft und abstoßend (so das öffentliche Echo) oder ein eher müder und missratener Wortwitz? Schon am nächsten Tag sah sich Dittrich gezwungen, sein Amt niederzulegen. Die FDP sah ihre Wählerchancen in der älteren Generation gefährdet.
Wer meint, hier werde die Zukunft zu schwarz gemalt, sollte Stanley Kurtz' (Stanford University, USA) Beitrag in Ausgabe 2-3/2005 der "Policy Review" lesen, der den neueren Literaturstand zu den ideologischen Folgen des demografischen Wandels zusammenträgt. Besonders faszinierend ist seine kritische Auseinandersetzung mit Phillip Longmans Buch "The Empty Cradle", in dem diskutiert wird, was es für die Gesellschaften der Zukunft bedeuten könnte, Kinderarmut zunehmend als Problem zu erkennen.
Die postmaterialistischen Bewegungen der 60er bis 80er Jahre - Umweltbewegung, Feminismus, sexuelle Befreiung - wurden durch die allgemeine Sorge vor der Bevölkerungsexplosion begünstigt. Die Erkenntnis, dass unser wahres Problem der Kindermangel sein könnte, - so argumentieren Kurtz und Longman - könnte diese Haltungen in die Defensive drängen und anstelle dessen religiöse Rechte, Traditionalismus und antiliberales Denken stärken. Letztlich werden Errungenschaften moderner, säkularer Gesellschaften in Frage gestellt - Errungenschaften, von denen wir doch dachten, sie hätten sich endgültig durchgesetzt. Steht eine Krise der Moderne ins Haus?
Zugegeben, diese Thesen wirken überzogen. Aber sie gewinnen an Plausibilität, wenn man sie etwas tiefer hängt und über graduelle Werteverschiebungen anstelle radikaler Umschwünge nachdenkt. Man wird eingestehen müssen, dass seit den 80er Jahren gewisse Verschiebungen in die von den Autoren genannten Richtungen stattgefunden haben. Man denke an die religiöse Rechte in den USA. Im Vergleich zu den 70er und 80er Jahren haben konservative Werte wieder an Boden gewonnen. Auch wenn der demografische Wandel diesen Umschwung nicht herbeigeführt hat, so hat er ihn doch zumindest begünstigt. Oder noch vorsichtiger: Er stand und steht ihm offensichtlich nicht entgegen.
Wie glücklich sind Menschen mit und ohne Kinder?
Und wie glücklich werden wir in der kinderarmen Gesellschaft sein? Eine Frage, die der sozialwissenschaftlichen Forschung nicht zugänglich ist. So sollte man meinen. Weit gefehlt! In einer technisch beeindruckenden Studie analysieren Hans-Peter Kohler von der University of Pennsylvania, USA, Jere R. Behrmann vom Massachusetts Institute of Technology und Axel Skytthe von der dänischen Syddansk Universität anhand von Umfragedaten den Einfluss von Partnerschaften und Kindern auf das subjektive Glücksempfinden. Dokumentiert wird die Studie in der Ausgabe 3/2005 des "Population and Development Review".
Dabei gelingt es den Forschern, ein verteufeltes methodisches Problem zu lösen. Psychologen sagen, dass das subjektive Wohlempfinden zumindest zum Teil genetisch bedingt und über den Lebenszyklus hinweg erstaunlich stabil ist. Wäre nicht viel plausibler, dass dieses Glücksgefühl die Bereitschaft zur Familiengründung beeinflusst (und nicht umgekehrt)? Und wenn beides gleichzeitig der Fall ist: Wie kann die Forschung den Teil des Glücks "herausfiltern", der ursächlich auf Partnerschaft und Kinder zurückgeht?
Der Trick der Demografen: Sie greifen auf einen Datensatz zurück, der auf einer groß angelegten Befragung von eineiigen Zwillingen in Dänemark beruht. Den Autoren stehen Daten über Altersgruppen zwischen 25 und 45 Jahren und zwischen 50 und 70 Jahren zur Verfügung. Finden sich nun in den jeweiligen Geschwistervergleichen statistische Zusammenhänge zwischen familiärer Situation und Angaben über das persönliche Glücksempfinden, kann ausgeschlossen werden, dass in Wahrheit genetische Veranlagungen für die Befunde verantwortlich sind.
Die Ergebnisse der Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen: Allgemein hängt das persönliche Glücksempfinden erstaunlich wenig von Faktoren wie Bildung, Beruf und Einkommen ab. Partnerschaft und Kinder wirken sich hingegen systematisch auf das persönliche Glück aus. Männer und Frauen sind glücklicher, wenn sie in Partnerschaft leben (gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind nicht Gegenstand der Untersuchung). Allerdings schöpfen Männer aus Partnerschaften mehr Glück als Frauen! Die Anzahl früherer Partnerschaften (auch Anzahl von Scheidungen) scheint das Glücksempfinden weder positiv noch negativ zu beeinflussen. Beide Partner, besonders aber Frauen, macht das erste Kind glücklich.
Mit weiteren Kindern geht das Glücksempfinden der Frauen, nicht aber der Männer, etwas zurück. Männer, nicht aber Frauen, schöpfen aus der Geburt des ersten Kindes mehr Glück, wenn es sich um Söhne handelt; und Stiefkinder reduzieren das Glück von Männern, aber nicht von Frauen. Wird das erste Kind früh (bevor die Mutter 21 Jahre alt ist) geboren, reduziert dies das persönliche Glück der Frau, nicht aber des Mannes. Und für die 50- bis 70-Jährigen ist es irrelevant, ob sie einmal Kinder großgezogen haben: Das Kinderglück ist vergänglich.
Fazit: In einer Gesellschaft ohne Kinder wären wir zweifellos unglücklicher, aber nicht unbedingt in einer Gesellschaft mit wenigen Kindern. Das persönliche Glück, so das entscheidende Ergebnis bei Kohler, Behrmann und Skytthe, ist vor allem mit dem ersten Kind verbunden. Ein-Kind-Familien reichen zur Korrektur der demografischen Ungleichgewichte natürlich nicht aus. Politische Reformen, vor allem hinsichtlich staatlich geförderter Kinderbetreuung und hinsichtlich der Chancen zum Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt, sind zur Unterstützung junger Familien unumgänglich.
Mit schlanker Hand ist das nicht zu bewerkstelligen. Der Staat muss Geld in die Hand nehmen, und das muss irgendwo herkommen. Es führt kein Weg an der Erkenntnis vorbei: Die Generationen sind in Verteilungskämpfe verstrickt. Werden sie zu Ungunsten der jungen Familien gelöst, werden uns bald vielleicht nicht Kindermangel, sondern deren langfristigen Folgen unglücklich machen: Kaputte Sozialsysteme, reale Schrumpfung und - sofern wir den Argumenten von Kurtz und Longman folgen wollen - ein wiedererstarkter antiliberaler Traditionalismus.
Zum Weiterlesen
Die Zeitschriftenaufsätze
James W. Vaupel und Elke Loichinger (2006): Der demografische Wandel wird schon bald etwas kosten, in: Demografische Forschung aus Erster Hand 3, 1, 1-2.
Achim Goerres (2006): Why are Older People more Likely to Vote? The Impact of Ageing on Electoral Turnout across Europe, in: British Journal of Politics and International Relations (im Erscheinen). Darüber hinaus wird hier über Forschungsergebnisse berichtet, die über die Homepage des Autors zugänglich sind: http://personal.lse.ac.uk/goerres/work.htm
Stanley Kurtz (2005): Demographics and the Culture War, in: Policy Review No. 129, 2/3, 33-46.
Hans-Peter Kohler, Jere R. Behrmann und Axel Skytthe (2005): Partner + Children = Happiness? The Effects of Partnerships and Fertility on Well-Being, in: Population and Development Review 31, 3, 407-445.