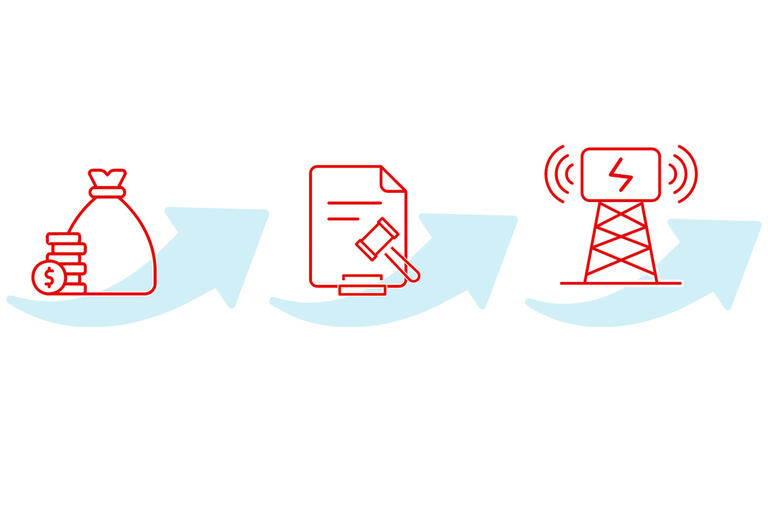: Investoren auf Einkaufstour in Deutschland
Amerikanische Fonds kaufen deutsche Unternehmens-Beteiligungen, um sie gewinnbringend wieder zu verkaufen. Die Renditeerwartungen sind kurzfristig und hoch - das bringt erhebliche Risiken für die Arbeitnehmer mit sich. Doch der Zufluss von Kapital und Know-how kann sich auch als Chance erweisen.
Von Christof Balkenhol
Dr. Christof Balkenhol (Matrix GmbH, München) berät Betriebsräte und Gewerkschaften in strategischen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Christof.Balkenhol@t-online.de
Auf den ersten Blick fällt es schwer, Gemeinsamkeiten zu erkennen - zwischen dem Turbinenhersteller MTU und dem Dualen (Abfall-)System Deutschland, zwischen dem Chemieunternehmen Dynamit Nobel und der Autowerkstattkette A.T.U. Erst ein Blick auf die Eigentümerstruktur macht deutlich: Hinter all diesen Unternehmen steht mit KKR (Kohlberg, Kravis, Roberts) eine der großen amerikanischen Private-Equity-Gesellschaften als Eigentümer.
Auch die Restaurantkette Nordsee, der Mobilfunkanbieter Debitel, der Brillenhersteller Rodenstock, das Chemieunternehmen Celanese oder der Armaturenhersteller Grohe sind im Besitz von Private-Equity-Gesellschaften.
Geld beschaffen und Geld ausgeben
Amerikanische Unternehmen versprechen sich auf dem deutschen Markt lukrative Beteiligungschancen. Und deshalb sind US-Gesellschaften wie KKR und Fortress, Cerberus und Blackstone, aber auch europäische Gesellschaften wie Apax und Permira fast immer mit im Rennen, wenn so genannte Buy-outs anstehen: Unternehmensteile sollen aus einem Konzernverbund herausgelöst und verkauft werden, oder ein großes mittelständisches Unternehmen sucht einen neuen Eigentümer.
Laut Handelsblatt sind in Deutschland im Jahr 2004 zirka 23 Milliarden Euro an Finanzierungen durch Private-Equity-Fonds platziert worden; etwa doppelt so viel wie im Vorjahr. Fachleute sind sich einig: Diese Art der Finanzierung wird insbesondere in Deutschland noch erheblich wachsen.
Das Geschäftsmodell der Private-Equity-Gesellschaften läuft in drei Schritten: Sie beschaffen sich zunächst Kapital bei institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds und Versicherungen oder bei vermögenden Privatleuten, die einem von der Gesellschaft betreuten Fonds ihre Finanzmittel zur Verfügung stellen. Mit den Mitteln dieses Fonds erwerben die Gesellschaften dann Anteile an Unternehmen, das heißt, sie werden zu Eigentümern und stellen Eigenkapital. Aufgrund des "privaten", also außerbörslichen Charakters wird diese Finanzierung als Private Equity bezeichnet.
Die Investoren versuchen anschließend, ihre Beteiligung in einem begrenzten Zeithorizont mit deutlicher Wertsteigerung wieder zu veräußern. Die erzielten Wertsteigerungen fließen in den Fonds zurück und erwirtschaften damit die Erträge für die Anleger. Die Renditeerwartungen der Fondsanleger sind mit zehn bis 20 Prozent pro Jahr auf das eingesetzte Kapital ausgesprochen hoch, denn die Investments sind mit erheblichen Risiken verbunden.
Prominente Beispiele machen deutlich, dass bei Fehlinvestitionen auch große Verluste drohen. So berichtete das manager magazin im August 2004, dass die Finanzinvestoren bei der Privatisierung der Bundesdruckerei zirka eine Milliarde Euro abschreiben mussten.
Turn-around-Fonds kaufen krisengeschüttelte Unternehmen
Private-Equity-Gesellschaften verfolgen in ihrer Investitionspolitik unterschiedliche Strategien, um Wertsteigerungen zu erzielen. Einige Unternehmen konzentrieren sich auf die Beteiligung an wachstumsstarken Technologieunternehmen. Andere Gesellschaften bemühen sich, Beteiligungen zu erwerben und so zusammenzufügen, dass zwischen den Beteiligungen Synergien entstehen. Turn-around-Fonds haben sich darauf spezialisiert, Unternehmen in Krisensituationen zu kaufen, sie zu sanieren und anschließend wieder zu veräußern.
Ihren teilweise schlechten Ruf hat sich die Branche durch diejenigen Geschäfte erworben, die nach dem Erwerb einer Beteiligung in erster Linie auf eine schnelle Veräußerung von Vermögenswerten und auf eine Zerschlagung von Strukturen zielen. Als Beispiel wird hier des Öfteren der Einstieg von KKR beim amerikanischen Nahrungsmittelkonzern Nabisco und die anschließende Zerschlagung des Unternehmens genannt - das war Ende der 80er Jahre.
Die meisten Private-Equity-Gesellschaften wollen ihre Beteiligung in der Regel nach fünf bis zehn Jahren wieder veräußern. Dafür stehen grundsätzlich drei Wege offen:
- Das Unternehmen wird im Zuge eines Börsengangs am Kapitalmarkt platziert, die Alteigentümer verkaufen ihre Anteile an die neuen Aktionäre. KKR hat im letzten Jahr beispielsweise den Geldautomatenhersteller Wincor-Nixdorf erfolgreich an die Börse gebracht. Nach dem Platzen der New-Economy-Blase und dem damit verbundenen massiven Vertrauensverlust der Anleger ist dieser Weg in den letzten beiden Jahren jedoch extrem erschwert. So wurden 2004 mangels Anlegerinteresse die geplanten Börsengänge von Nordsee und A.T.U. abgesagt.
- Die Private-Equity-Gesellschaft verkauft ihre Beteiligung an einen industriellen Partner, der sein Portfolio ergänzen will und das neu erworbene Unternehmen in sein Geschäftssystem integriert. Konjunkturelle Unsicherheiten haben in den letzten beiden Jahren dazu geführt, dass deutsche Konzerne zwar häufig als Verkäufer, aber nur sehr selten als Käufer von Unternehmen aus dem Besitz von Finanzinvestoren in Erscheinung treten.
- Wenn die beiden ersten Optionen nicht realisiert werden, kann die Beteiligung an einen Finanzinvestor weitergereicht werden (so genannte Secondary Buy-outs). Gerade diese Variante wurde in der jüngsten Zeit vermehrt realisiert, zum Beispiel beim Automobilzulieferer Honsel, beim Armaturenhersteller Grohe oder dem Dentaltechnikunternehmen Sirona.
Auf lange Sicht droht der Finanzkollaps
Die Geschäfte zwischen Finanzinvestoren können in Einzelfällen sinnvoll sein, die von den Investoren erwarteten Wertsteigerungen sind auf Dauer jedoch nur durch Börsengänge bzw. durch Veräußerung an industrielle Partner zu erzielen. Kritiker sehen hier einen wichtigen Schwachpunkt des Private-Equity-Ansatzes: Viel zu selten gelingen Börsengänge oder Verkäufe an Industriepartner, die Branche macht zu viele Geschäfte mit sich selbst, auf lange Sicht droht ein Finanzierungskollaps.
Im Vergleich zu den angelsächsischen Ländern ist der Private-Equity-Markt in Deutschland bislang noch nicht sehr ausgeprägt. Absehbar werden die Transaktionen weiter zunehmen. Das hat Gründe:
- Die amerikanischen Gesellschaften betrachten deutsche Unternehmen als ausgesprochen wettbewerbsfähig und erwarten, dass die eingeleiteten Arbeitsmarkt- und Sozialreformen die wirtschaftlichen Entwicklungschancen in Deutschland positiv beeinflussen. Sie suchen deshalb sehr aktiv nach geeigneten Kandidaten für Buy-outs und Eigentümerwechsel.
- Große Konzerne bauen ihre Geschäftsfelder um und trennen sich von Randaktivitäten, aber auch von ganzen Geschäftsbereichen. So hat die mg technologies im Jahr 2004 ihre Chemiesparte Dynamit Nobel für 2,25 Milliarden Euro an KKR und CSFB verkauft (siehe Seite 38) Die E.On AG plant zur Zeit den Verkauf ihrer Immobiliengesellschaft Viterra, als Bieter werden fast ausschließlich Private-Equity-Gesellschaften genannt.
- Mittelständische Unternehmen sind auf der Suche nach neuen Finanzierungsformen, seit die Geschäftsbanken ihre Kreditpolitik massiv verändert haben. Gleichzeitig stehen in den nächsten zehn Jahren im Mittelstand zahlreiche Unternehmen vor einem bislang ungelösten Nachfolgeproblem. Während sich die amerikanischen Investoren dabei vor allem an großen Transaktion beteiligen, konzentrieren sich in diesem Segment zahlreiche deutsche Beteiligungsunternehmen auf kleinere Engagements.
- Angesichts der Finanzlage der öffentlichen Haushalte stehen in vielen Bereichen Privatisierungen auf der Tagesordnung. So wurde die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) im vergangenen Jahr von der Bundesregierung bewogen, ihr Immobilienunternehmen GAGFAH zum Preis von rund 3,5 Milliarden Euro (bei diesem offiziell genannten Preis sind aber 1,2 Milliarden Euro Unternehmensverbindlichkeiten eingerechnet) an die amerikanische Fortress-Gruppe zu veräußern (siehe Seite 36).
Private-Equity-Gesellschaften profitieren davon, dass sich die Politik deutscher Banken angesichts milliardenschwerer Ausfälle bei ihren Kreditengagements massiv verändert hat. Der Kapitalbedarf der Unternehmen wird nicht mehr ausreichend durch entsprechende Finanzierungsangebote der Banken bedient. Hier treten alternative Finanzierungsformen wie Private Equity auf den Plan.
Bei den großen Transaktionen ab 500 Millionen Euro Volumen sind dabei die angelsächsischen Gesellschaften fast immer unter sich, weil sie über entsprechende Finanzmittel verfügen. Nach einem Bericht der Wirtschaftswoche können sowohl Blackstone und KKR als auch die britische Permira Gruppe aus ihren Fonds jeweils mehr als fünf Milliarden Euro in Unternehmensbeteiligungen investieren.
Die Fonds rollen die Deutschland AG auf
"Retter oder Räuber?" titelte das manager magazin. Die deutsche Wirtschaftspresse sucht noch nach Antworten, wenn es um die Rolle amerikanischer Beteiligungsgesellschaften in Deutschland geht. In einem ZEIT-Interview betonte ein deutscher KKR-Partner, die Private-Equity-Gesellschaften sähen sich als Katalysatoren beim Strukturwandel der Deutschland AG.
Doch angesichts der enormen Finanzmittel, die bei solchen Transaktionen investiert werden, verbunden mit hohen Renditeerwartungen, wie auch angesichts einiger spektakulärer Fehlschläge ist ein kritischer Blick auf die Risiken angebracht. Für Arbeitnehmerinteressen sind dabei insbesondere zwei Aspekte wichtig:
- Die Renditeerwartungen der Investoren lösen massiven Druck auf Effizienzverbesserungen im operativen Geschäft aus. Wegen kurzfristiger Wirksamkeit ist damit die Gefahr verbunden, dass insbesondere Personalabbau zu einem bevorzugten Instrument der Produktivitätssteigerung wird. Der kurze Zeithorizont der Investoren kann dazu führen, dass eine langfristige Ausrichtung des Unternehmens unterbleibt und stattdessen alle Entscheidungen unter dem Blickwinkel rascher Ergebniswirksamkeit erfolgen.
Auf diesem Weg kann zum Beispiel die Investition in langfristige F&E-Aktivitäten zurückgefahren und damit auf lange Sicht die Wettbewerbsposition deutlich geschwächt werden. So berichtet das manager magazin, dass beim Gartengerätehersteller Gardena in Ulm ein Jahr nach Übernahme durch eine Private-Equity-Gesellschaft der zunächst eingeschlagene Wachstumskurs durch ein massives Einsparprogramm ersetzt wurde - Personalabbau inklusive.
Der Belegschaft wurde "aus Gründen der Sicherung langfristiger Wettbewerbsfähgkeit" ein kurzfristiges Verzichtspaket präsentiert. Diese Abweichung vom Tarifvertrag weist die IG Metall Ulm als wirtschaftlich unbegründet zurück, hier zeichnen sich bereits heftige Konflikte ab.
- In der Regel wird der Kaufpreis nicht ausschließlich durch Eigenkapital der Private-Equity-Gesellschaft finanziert, sondern zu Teilen mit Fremdkapital (so genannte Leveraged Buy-outs). Das übernommene Unternehmen muss Zins- und Tilgungsleistungen für die Darlehen häufig aus dem eigenen Cash-Flow finanzieren. Hier besteht die Gefahr des "Ausblutens" mit einer bedrohlichen Schwächung der Finanzkraft des Unternehmens.
Den Flugzeugbauer Fairchild Dornier hat eine amerikanische Beteiligungsgesellschaft zunächst zum Preis von 1,2 Milliarden Euro übernommen. Das Engagement endete 2002 mit der ersten und 2004 mit der endgültigen Insolvenz des Traditionsunternehmens - mehrere Tausend Arbeitsplätze gingen verloren.
Neue Besitzer machen dem Management Beine
Amerikanische Investoren sind im Umgang mit den Besonderheiten der deutschen Mitbestimmung häufig wenig geübt. Während des notwendigen "Lernprozesses" treten nicht selten Missverständnisse zwischen Betriebsräten bzw. Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat und den neuen Eigentümern auf. Die Investoren setzen sich allerdings in jüngster Zeit intensiver mit der Mitbestimmung auseinander. Sie erkennen dabei durchaus die Vorzüge des deutschen Modells an.
Mitbestimmung helfe bei Anpassungsprozessen, heißt es zum Beispiel. Man habe "gute Erfahrungen" mit der deutschen Mitbestimmung gemacht, erklärte KKR-Europachef Huth (siehe auch Seite 39). Anders als in der Öffentlichkeit häufig kolportiert, wirkt die Mitbestimmung offensichtlich keinesfalls abschreckend auf amerikanische Investoren - im Gegenteil.
Neben den Risiken sollte man aber auch aus dem Blickwinkel der Arbeitnehmerinteressen die Entwicklungsmöglichkeiten ins Kalkül ziehen, die der Einstieg einer Private-Equity-Gesellschaft in ein Unternehmen bieten kann:
- Um Wertsteigerungen zu erzielen, sind die Finanzinvestoren häufig bereit, im Unternehmen Wachstumsinvestitionen zu tätigen. Auf diesem Wege besteht die Möglichkeit, die Wettbewerbsposition nachhaltig zu verbessern.
- Geschäftsbereiche, die nicht zum Kerngeschäft eines Unternehmens gehören, führen ein ständig bedrohtes Schattendasein, weil sie weder in der Gunst der Geschäftsführung stehen noch in der Aufmerksamkeit von Investitionsentscheidungen. Hier kann die Herauslösung aus dem Konzernverbund als echte Entwicklungschance begriffen werden, weil aus einer Randaktivität plötzlich das Kerngeschäft der neuen Gesellschaft wird.
Als Beispiel kann hier die Verselbständigung zweier Siemens-Bereiche genannt werden: Das Geldautomatengeschäft (Wincor-Nixdorf) und das Dentalgeschäft (Sirona) wurden mit Hilfe von Finanzinvestoren aus dem Konzern herausgelöst.
- Private-Equity-Gesellschaften haben in der Regel einen deutlich unternehmerischeren Blick als andere Finanziers. Ihr Geschäftsmodell erfordert eine starke Konzentration auf Wachstumschancen und verhindert eine Beschränkung auf reine Risikovermeidung. So ist zum Beispiel der Einstieg eines Turn-around-Fonds bei einer massiven Unternehmenskrise oft die einzige Möglichkeit, Finanzierung und Liquidität sicherzustellen und eine Insolvenz zu vermeiden.
- Die Investoren mischen sich in der Regel kaum ins operative Geschäft eines Unternehmens ein, sondern konzentrieren sich auf eine Professionalisierung des Management-Systems. Dazu zählen insbesondere wirkungsvolle Controlling- und Reportingsysteme. Auf diese Weise wird häufig auch eine "Mobilisierung" von Top-Management und Führungskräften sichergestellt.
Der wachsende Druck auf das Management und straffere Reportingsysteme sind sicher auch ein Grund dafür, dass der Einstieg von Private-Equity-Gesellschaften bei Führungskräften nicht immer auf ungeteilte Begeisterung stößt.