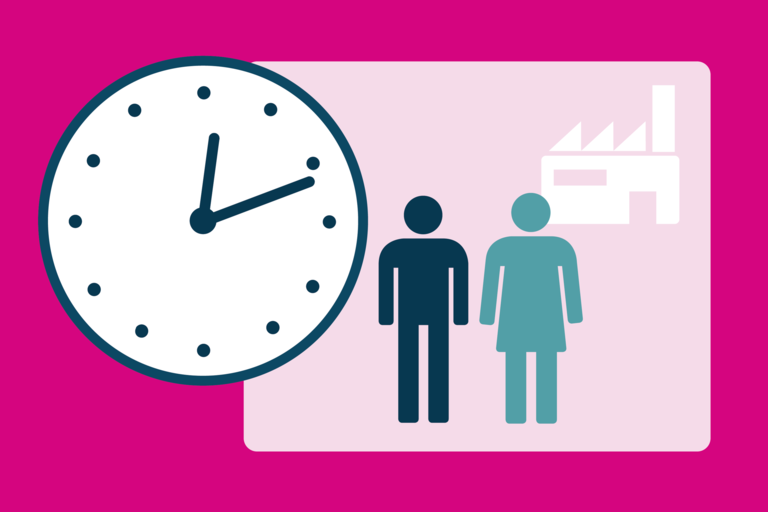: 'Freie Zeit bedeutet Glück'
Wohlstand hat nicht nur mit Gütern zu tun - das ist die Botschaft des Zeitforschers Jürgen P. Rinderspacher. Er plädiert für eine breite Diskussion um eine konsistente Zeitordnung, für strikte Pausen und die Umverteilung von Arbeit. Doch der Leistungsdruck und die Arbeitszeiten steigen.
Herr Rinderspacher, Stress bestimmt unser Leben, obwohl unser Lebensstandard viel höher ist als der früherer Generationen. Wie kommt das?
Unser Zeitempfinden ist eine Folge der Industrialisierung. Früher gab es einen ursprünglichen Zeitwohlstand. Zeit hatte noch keinen ökonomischen Wert. Die Menschen haben, wie Kinder oder Alte, nicht so rigide in Kategorien von Zeit gedacht. Erst seit 200 Jahren gibt es überhaupt ein Zeitproblem. Der Markt zwingt uns, genau auf die Art der Zeitverwendung zu gucken. Die Arbeitsbedingungen sind dichter als früher - zugleich dürfen oder müssen wir in der Freizeit zwischen immer mehr Möglichkeiten wählen. Sogar im Urlaub stehen wir unter dem Zwang, Lernerfolge vorweisen zu können - und sei es beim Skikursus. Nichtstun ist verdächtig. Das setzt auch die Freizeit enorm unter Druck.
Feste, verbindliche Zeittakte verlieren an Bedeutung. Je flexibler wir sind, desto mehr müssen wir unsere Zeit koordinieren. Ein Nullsummenspiel?
Der Nettoertrag sinkt durch die zusätzliche Koordination. Bis in die 90er Jahre haben wir aber unter dem Strich Freizeit dazubekommen. Jetzt läuft der Trend umgekehrt: Wir müssen darüber sprechen, was wir mit weniger Freizeit anfangen. Der Koordinationsaufwand wird damit aber nicht geringer.
Die Zeitphilosophen sind, wie es scheint, in Bedrängnis geraten. Nicht nur bei DaimlerChrysler.
Die Zeiten sind in der Tat ganz schlecht, jedenfalls für Forderungen nach Zeitsouveränität. Anders als früher ging der Druck in der Anfangsphase aber weniger von den Tarifparteien als von der Politik aus. Es war der öffentliche Dienst, der zuerst in Windeseile eine Arbeitszeitverlängerung umsetzte und den Arbeitgebern damit die Vorlage lieferte.
Warum, glauben Sie, fordern Manager und Politiker längere Arbeitszeiten?
Sie folgen einem neoliberalen Paradigma. Ökonomen wie Hans-Werner Sinn, der Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, argumentieren so: Um keine Kaufkraft zu verlieren, sei es besser, Arbeitszeiten zu verlängern statt Löhne zu kürzen. Langfristig geht es um die Senkung der Arbeitskosten. Diese Leute sind bereit, durch eine Phase noch höherer Arbeitslosigkeit zu gehen - für das vage Versprechen, in der Zukunft könne der Absatz durch niedrigere Herstellungskosten steigen. So etwas kann nur jemand fordern, dessen Job nicht an Wahlen hängt.
Zumindest die Unternehmer, die über hohe Arbeitskosten klagen, müssten von solchen Forderungen begeistert sein.
Es gibt eine neue Untersuchung des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) - dort wird ersichtlich, dass Arbeitgeber nur zu einem Drittel Arbeitszeitverlängerungen vorbehaltlos befürworten. Die Firmen, die jetzt vorpreschen, sind nicht die mit den größten wirtschaftlichen Schwierigkeiten - es sind die Großunternehmen wie Siemens oder DaimlerChrysler. Hier wird auch symbolisch Politik gemacht.
Die Arbeitnehmer sind gleichwohl in der Defensive. Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?
Man hat die Machtfrage bisher viel zu wenig beachtet. Ich denke, dass die Diskussion um die Arbeitszeiten viel politischer sein muss als in den 80er und 90er Jahren. Einige meiner Kollegen scheinen das noch nicht begriffen zu haben. Sie sehen nicht, dass die Verhältnisse sich völlig umgekehrt und dramatisch politisiert haben. Die Arbeitnehmer und die Gewerkschaften sollen vorgeführt werden.
In den Zeitungen lesen wir fast täglich von neuen Vorschlägen zur Arbeitszeit.
Es gibt keine Zeitinstitution, egal ob Urlaub, Pause, oder Wochenende, die nicht von irgendeinem Politiker in Frage gestellt wird. Aber die Vorschläge sind nicht miteinander kompatibel. Die so genannte Steinkühler-Pause zu streichen und dann zu fordern, dass die Leute bis 70 arbeiten, passt nicht zusammen.
Wie sollen sich die Gewerkschaften verhalten?
Wenn es ihnen gelänge, die Debatte auf die Widersprüche zu lenken und eine einigermaßen konsistente Zeitordnung einzufordern, wäre das schon ein Schritt nach vorn.
In Ihren Texten zeichnen Sie nach, wie frei verfügbare Zeit zum Wirtschaftsgut geworden ist. Müssten Sie als Mann der Kirche nicht ein anderes Zeitverständnis propagieren?
Ich bin Ökonom und kein Theologe. Biblisch ist die Zeit von Gott gegeben - aber der Umgang der Menschen mit der Alltagszeit ist eine Folge der Industrialisierung. Zeit wird immer kostbarer, weil durch die steigende Produktivität pro Zeiteinheit immer mehr Güter produziert werden können. Aus diesem scheinbaren Dilemma kommen wir - wenn überhaupt - nur heraus, indem wir zum Ziel erklären, nicht nur Güter, sondern auch freie Zeiteinheiten zu produzieren. Wollen wir unseren Wohlstand ausschließlich an Gütern messen, oder auch in freier Zeit?
Noch lieber nehmen die Menschen wahrscheinlich Geld. Denn das kann man sparen.
Anfang der 90er Jahre kam bei Umfragen immer heraus, dass die Menschen weniger arbeiten wollen, auch, wenn sie dadurch weniger verdienen. Dann kam der Umbruch, durch Kostensteigerungen oder durch die Rentendebatte. Die Menschen merkten, dass sie größere Teile des Einkommens brauchen, um ihr Leben langfristig zu sichern. Aber ich glaube, dass das nicht den wirklichen Bedürfnissen entspricht. Die Einkommenspräferenz steigt, aber das geschieht aus der Not heraus. Alles kann sich wieder ändern, wenn es der Wirtschaft besser geht.
Paradoxerweise verfügen gerade die Arbeitslosen über mehr Zeit, als ihnen lieb ist. Das ist gerade das Gut, das Ihrer Ansicht nach das Wohlstandsgut der Zukunft wird.
Zeitwohlstand ist die Freiheit, zwischen Gütern und Zeitkontingenten zu wählen. Arbeitslose haben diese Wahl nicht. Sie fühlen sich mit ihrer Zeit so schlecht, als hätten sie keine. Es wäre zynisch, in ihnen die eigentlich Reichen zu sehen. Ihr hohes Zeitbudget ist Ausdruck der sozialen Marginalisierung.
Wie kann man diesen Leuten helfen?
In der Kohl-Ära haben Kirchen und Gewerkschaften die Initiative "Arbeit - Leben - Zeit" gegründet. Wir wollten einen Großversuch zur Arbeitsumverteilung, aber der kam nicht. Auch im Bündnis für Arbeit gab es gegenüber dieser Frage praktisch keine Rückendeckung. Doch an der Vision vom Zeitwohlstand halte ich fest, auch wenn ich für die Umsetzung im Augenblick wenig Perspektiven sehe.
Sie sind ein Überzeugungstäter.
Wir haben doch in den letzten zwanzig Jahren alle möglichen Flexibilisierungs-Modelle durchprobiert. Wir hatten große Hoffnungen - darum tut es mir weh, was ich sage: Es muss auf die politische Handhabbarkeit geachtet werden. Wir können nicht weiter jedem Sonderwunsch eines einzelnen Arbeitnehmers nachrennen. Seit zehn Jahren klagen die Betriebsräte, dass sie die vielen Modelle nicht mehr überblicken können. Sie werden vom Management gnadenlos ausgehebelt.
Was bedeutet das? Eine einheitliche Arbeitszeit für alle?
Ich bin für das, was unter anderem die Kollegen am Institut Arbeit und Technik "neue Normalarbeitszeit" nennen. Der Vorteil einer standardisierten Arbeitszeit von sechs Stunden täglich wäre, dass sie besser handhabbar ist. Es ist Zeit, dass wir die Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen: Bringt das neueste Modell zur Flexibilisierung wirklich noch etwas, oder sind das eher filigrane Probleme gegenüber der Frage, wie wir Arbeitsplätze im Land halten - im Weltmaßstab gesehen? Wenn wir durch einen Standard wie 5000 x 5000 unsere Arbeitsplätze wirklich sicherer machen könnten, können wir darüber reden. Das ist dann eben der Preis der Anpassung an den Weltmarkt.
Beim VW-Modell 5000 x 5000 gibt es hoch flexible Arbeitszeiten, die "atmende Fabrik". Sie dagegen fordern die 30-Stunden-Woche.
Vor dem Hintergrund der Arbeitszeitoffensive der Arbeitgeber mag das ja wie eine Gespensterdiskussion erscheinen. Aber ein besseres Rezept gegen die Arbeitslosigkeit hat noch niemand gefunden. Wer die Umverteilung ablehnt, muss sagen, wo die Arbeitslosen bleiben.
Viele Leute bezweifeln, dass Umverteilung das geeignete Mittel ist, Arbeitsplätze zu erhalten.
Man kann ja die Konzession machen, sich durch eine forcierte Flexibilisierung dem internationalen Wettbewerb zu stellen. Aber man kann auf der anderen Seite auch sagen: Dafür verlangen wir eine sechsstündige Normalarbeitszeit. Schichtarbeit kann man statt mit acht Stunden auch mit sechs Stunden machen. Das schadet den Unternehmen im Grunde nicht. Man muss nur darüber reden, ob man das mit oder ohne Lohnausgleich macht.
Sie gehen von einem sinkenden oder stagnierenden Arbeitsvolumen aus. Kann man es nicht genauso gut vergrößern?
Das neoliberale Modell versucht das durch niedrigere Löhne: Die Wirtschaft produziert immer mehr und billigere Produkte, der Absatz steigt, und am Ende kommen alle rein in den Arbeitsmarkt. Aber das ist eine naive Vorstellung. Welche Produkte sollen wir denn noch auf dem Weltmarkt anbieten? Das eigentliche Problem ist der Verlust von Märkten. Wenn Toll Collect oder der Transrapid Exportschlager wären, hätten wir viele Probleme nicht.
Immerhin sind wir Exportweltmeister. Aber Sie haben Recht: Andere Länder holen auf.
Ich finde es gar nicht schlecht, dass andere Länder, wie die asiatischen Tigerstaaten, die ehemaligen Ostblockstaaten und hoffentlich auch Afrika aus eigener Kraft in der Lage sind, effiziente Volkswirtschaften aufzubauen. Das haben wir doch immer gewollt - dafür ist jahrzehntelang Entwicklungshilfe gezahlt worden. Zu unserem Entsetzen passiert das nun nicht durch unsere Almosen, sondern über den Markt. Warum ist ein Arbeitsplatz in Tschechien schlechter als einer in Deutschland? Wenn wir solidarisch denken, darf das keine Rolle spielen.
Das hören die Gewerkschaften bestimmt nicht gern. Sie sollen zusehen, wie Arbeitsplätze abwandern?
Was ich zu bedenken gebe, wäre eine ethisch konsequente Haltung. Solidarität stellt sich heute anders her als die Arbeiterbewegung sich das gedacht hat: nicht durch die kommunistische Revolution, sondern durch die kapitalistische. Das kann bedeuten, dass die hoch industrialisierten Länder mit weniger auskommen müssen. Das ist eine echte Herausforderung.
Sie predigen Verzicht. Gleichzeitig soll die Globalisierung die internationale Solidarität stärken?
Wir brauchen eine weltweite Perspektive. Über kurz oder lang werden wir den Druck, auch den ökologischen Druck des ständigen Wachstums gar nicht aushalten. Ich weiß: Solche Überlegungen sind mega-out, sogar bei den Grünen.
Wie ist es um die Solidarität in unserer eigenen Gesellschaft bestellt?
Früher hat man die Schwächeren einfach mitgenommen, in den Betrieben und in der Verwaltung. Es war ein kluges Verhalten, ein Auge zuzudrücken. Jetzt wird rationalisiert - jeder wird einzeln durchgecheckt, die Schwächeren fallen plötzlich auf und bleiben als eigene Gruppe zurück. Doch eine Gesellschaft ist gut beraten, die Schwachen nicht in einem Ghetto zu lokalisieren, sondern sie überall zu verteilen - nicht nur in Phasen der Prosperität. Wir brauchen ein neues Ethos der Nachsichtigkeit.
Lassen Sie uns über einige der großen Zeitinstitutionen reden, die die Arbeitswelt prägen. Welche Zukunft hat der Sonntag?
Ich spreche lieber vom Wochenende. Der traditionelle, mit Verhaltensregeln belegte Sonntag und der Samstag, der mit seinen Einkaufsmöglichkeiten eher dem Verständnis einer modernen pluralistischen Gesellschaft entspricht, gehören untrennbar zusammen.
Der Sonntag ist bis heute stark reglementiert. Schützt man die Menschen hier vor sich selbst?
Zunächst einmal schützt man die Arbeitnehmer. Am Sonntag gilt ein weitgehendes Arbeitsverbot für die gewerbliche Beschäftigung. Außerdem gibt es das Ruhegebot, das sich unter anderem in der deutschen Rasenmäherverordnung niederschlägt oder in dem Verbot, Autowaschanlagen zu betreiben. Das finde ich sehr gut so. Die aktuellen Konflikte mit dem religiösen Fundamentalismus zeigen, wie wichtig spirituelle Werte sind. Ich meine nicht religiöse Werte im engeren Sinne, sondern die Fähigkeit, den Alltag zu durchbrechen, eine andere Welterfahrung zu machen.
Und des Deutschen liebstes Kind, der Urlaub im Süden?
Er wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein Massenphänomen. Noch in den 60er Jahren sprachen Betriebsräte sich gegen Pausen während der Arbeitszeit aus - zu Gunsten der Fünftage-Woche und längerer Urlaubszeiten. Zwischen 1960 und 1985 hat sich das Urlaubsvolumen von etwa 15 Tagen auf fast 30 Tage erweitert. Seitdem gibt es kaum Veränderungen.
Die Leute fliehen jedes Jahr massenhaft aus dem Land, in dem sie arbeiten. Das kann nicht nur am Wetter liegen.
Es spricht auch gegen die Qualität unserer Städte. Sogar am Wochenende treibt es die Menschen auf das Land, nicht in die Metropolen. Die Werbung überhöht den Urlaub als schönste Zeit des Jahres. Wenn Horkheimer und Adorno noch leben würden, würden sie das als Zeichen eines falschen Bewussteins heftig kritisieren. So ein Urlaub kann schön sein, aber er darf nicht die Erfüllung des Lebens sein. Wenn die verfügbaren Einkommen sinken, können die Leute ohnehin nicht mehr so oft verreisen. Erholungszeiten brauchen wir jedoch mehr denn je, weil der Arbeitsstress wieder deutlich zunimmt.
Was könnte den klassischen Urlaub ersetzen?
Zum Beispiel Blockfreizeiten, für die Renovierung der Wohnung, für eine Zeit mit den Kindern - nicht nur, wenn sie gerade krank sind. Das ist ein Potenzial für Modernisierung. Wären wir noch in den 80er Jahren, könnten wir darüber kreativ diskutieren. Aber in der jetzigen politischen Situation, wo die Gewerkschaften gegenüber der Wirtschaft und auch der Regierung unter Druck stehen, kann man kaum raten, darüber öffentlich zu sprechen. Da bekommt man nur Beifall von der falschen Seite.
Warum halten Sie die Diskussion für gefährlich?
Blockfreizeiten stehen in einem gewissen Spannungsverhältnis zum freien Wochenende und auch zum klassischen Urlaub: Die Unternehmen hätten gern, dass Freizeiten dann genommen werden, wenn es den betrieblichen Erfordernissen entspricht. Demnach müssten viele Leute im November Urlaub nehmen. Die freie Urlaubsplanung ist aber ein hohes Gut. Wir lernen es erst jetzt wieder schätzen, wo es in Frage gestellt wird.
Eine private Frage zum Schluss: Wo können Sie am besten abschalten?
Am Sonntagmorgen höre ich gerne klassische Musik, oder ich gehe spazieren. In Münster, wo ich bis vor kurzem gelebt habe, gibt es einen schönen Kanal; jetzt muss ich mir an meinem neuen Wohnort in Hannover wieder einen schönen Platz suchen. Außerdem mache ich Rock- und Pop-Musik im eigenen Studio, manchmal zusammen mit meinen Kindern. Da vergesse ich die Zeit. Ich falle in einen ursprünglichen Zustand zurück, in dem Zeit keine Rolle spielt.
Das Gespräch führte Kay Meiners.
Zur Person
Jürgen P. Rinderspacher, Jahrgang 1948, ist gebürtiger Berliner und Doktor der Politik. Neben Wirtschafts- und Sozialwissenschaften hat er auch Theologie studiert. Seit 1992 ist er wissenschaftlicher Referent am Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland und Lehrbeauftragter an der Universität Münster und der FU Berlin. Zuvor war er viele Jahre als Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum Berlin, an der Freien Universität Berlin, an der Universität Münster sowie beim Amt für Industrie- und Sozialarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen tätig. Rinderspacher ist Mitbegründer und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik.
Literatur
Jürgen P. Rinderspacher: Ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage. Die soziale
und kulturelle Bedeutung des Wochenendes. Bonn, J.H.W. Dietz Verlag 2000.
160 Seiten, 10,12 Euro
Jürgen P. Rinderspacher (Hg.): Zeitwohlstand - Ein Konzept für einen anderen Wohlstand der Nation. Berlin, Edition Sigma 2002. 205 Seiten, 14,90 Euro
Jürgen P. Rinderspacher (Hg.): Zeit für alles - Zeit für nichts. Die Bürgergesellschaft und ihr Zeitverbrauch. Bochum, SWI Verlag 2003. 273 Seiten, 22 Euro