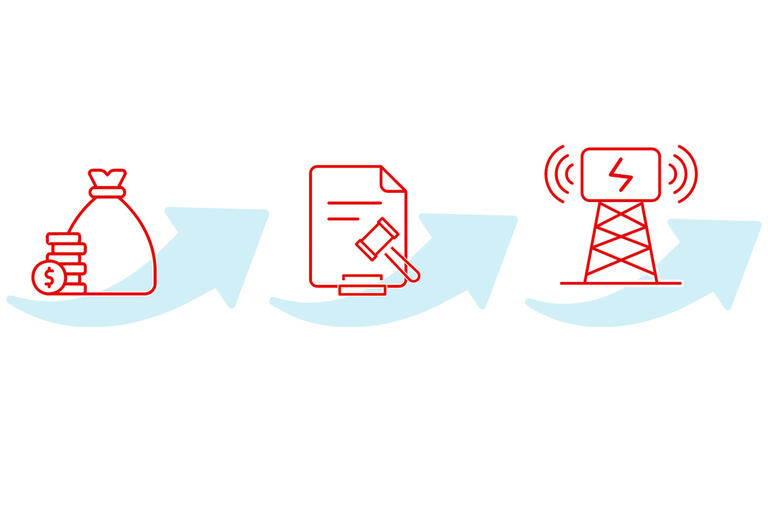: Adieu Neoliberalismus
WISSENSCHAFT Die Lindauer Tagung der Wirtschafts-Nobelpreisträger offenbart ein neues Interesse am Menschen und für die politische Ökonomie. Souveräne Politiker werden durch die Expertise der Wissenschaft nicht überflüssig.
Von HERBERT HÖNIGSBERGER, Publizist in Berlin/Foto: Christian Flemming
Um zu erfahren, woher der Wind in der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion weht, gibt es kaum eine bessere Gelegenheit als die Lindauer Tagung der Nobelpreisträger der Ökonomie, die in diesem Jahr zum dritten Mal stattgefunden hat. Vom 20. bis 23. August trafen am Bodensee 14 von Stockholm ausgezeichnete Weltökonomen und der Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus mit rund 300 jungen Wirtschaftswissenschaftlern aus 58 Ländern zusammen, beobachtet von 60 Journalisten aus dem In- und Ausland.
Die Veranstaltung wirft ein Schlaglicht auf die Differenz und die Distanz der internationalen ökonomischen Debatte zur eher provinziellen deutschen Diskussion. Einige der Nobelpreisträger lassen offen durchblicken, dass kein zwingender wissenschaftlicher Grund besteht, sich intensiver mit ihr auseinanderzusetzen. Auch ist unter ihnen nur ein Deutscher vertreten - der Spieltheoretiker Reinhard Selten, einer der Begründer der experimentellen Ökonomik, dem der Preis im Jahr 1994 zugesprochen wurde.
Viele der meist jungen Journalisten der deutschen Wirtschaftspresse, die angereist sind, sortieren die Nobelpreisträger pflichtschuldig in linke und rechte Wissenschaftler und versuchen, ausgewiesene Grundlagenforscher auf Positionen zu aktuellen wirtschaftspolitischen Fragen festzulegen. Doch verfügen die Forscher ihrerseits über eine Strategie gegen allzu offenkundige Funktionalisierungsversuche. Sie ziehen sich auf ihre Daten zurück und schieben - geschützt durch den Nachweis exzellenter Forschungsleistung - Nichtwissen oder Unzuständigkeit vor.
KRITIK AN DER WIRTSCHAFTSPOLITIK_ Einig sind sich die Preisträger in einer massiven Kritik an den Banken und im Verlangen nach weitreichender Regulierung des Finanzsektors. Längst stehen sich nicht mehr etatistische Regulierer und marktradikale Deregulierer gegenüber. Die Auseinandersetzung dreht sich vielmehr um die Subjekte, den institutionellen Rahmen, den Zeitpunkt, das Ausmaß und die Tiefe regulierender Interventionen. Für gut platzierte Konjunkturprogramme im Abschwung finden sich ebenso Kronzeugen wie für maßvolle Mindestlöhne als Rezeptur gegen die Ausweitung des Niedriglohnsektors.
Robert Solow, der 84-jährige Primus inter Pares der Preisträger, der einst im technischen Fortschritt den wichtigsten Träger wirtschaftlichen Wachstums erkannte, zieht auf Basis einer international vergleichenden Studie den weithin behaupteten positiven Effekt von Niedriglöhnen auf die Beschäftigungsquote in Zweifel und erklärt, er "verstehe die Angst vor dem Mindestlohn in Deutschland nicht". Keine Spur von einer Dominanz der Angebotsökonomik - die Rede ist nun von einer Mischung angebots- und nachfrageorientierter Maßnahmen, bei der es vor allem auf den Zeitpunkt der Implementation im Konjunkturverlauf, auf das rechte Maß und die intelligente Kombination von Programmkomponenten ankommt. Der Spieltheoretiker Reinhard Selten schlägt nicht nur eine gesetzliche Deckelung von Managergehältern vor - er regt auch an, deren Salär an betriebliche Mindestlöhne zu koppeln, und konstruiert damit einen Zusammenhang, bei dem die Manager selbst ein Interesse an Mindestlöhnen haben.
Nein, das Lindauer Forum gibt keinen Hinweis mehr auf eine wirtschaftsliberale Dominanz im globalen ökonomischen Diskurs. Impulse für die Trendumkehr liefern die internationale Finanzkrise, die Performance der amerikanischen Wirtschaft zwischen geplatzter Immobilienblase und Staatsverschuldung, vor allem aber das Versagen der US-Regierung. Auch der Nachwuchs der ökonomischen Elite, darunter gewiss mehr Frauen als sonst in der Branche, zu einem beträchtlichen Teil aus Nationalbanken und internationalen Institutionen rekrutiert, war mehrheitlich durchaus bereit, politisch korrekt und an den richtigen Stellen Solow oder Yunus zu applaudieren - oder Joseph Stiglitz, wenn er fordert, die Banken stärker zu regulieren, weil diese nicht in der Lage sind, Risiken zu managen, oder sich dafür ausspricht, "Finanzderivate einer staatlichen Zulassung zu unterziehen wie Medikamente". Diese Haltung und die Resistenz der Nobelpreisträger gegen eine Vereinnahmung für deutsche Kontroversen erklärt die gewisse Ernüchterung jener Medien, die ansonsten gern Hans-Werner Sinn, den Präsidenten des Münchener Ifo-Instituts, zitieren.
BEBEN IM ALTEN THEORIEGEBÄUDE_ Wichtiger noch als die wirtschaftspolitische Trendumkehr erscheinen die Veränderungen der theoretischen Grundlagen. Die versammelte Liga außergewöhnlicher Wissenschaftler hat ihre Reputation nicht zuletzt deshalb gewonnen, weil sie Theorien und Modelle erschüttert hat, die ihre Vorgänger aufgetürmt haben. Gewissheiten zu demontieren bereitet den meisten Preisträgern nach wie vor diebisches Vergnügen, auch ein altersradikales Umstürzlertum können sie sich leisten.
George A. Akerlof beispielsweise, der Experte, wenn es darum geht, welche Rolle asymmetrische Information für Marktversagen spielt, bezweifelt, ob es so etwas wie die Produktionsfunktion überhaupt gibt. Einem allzu eng gefassten Zusammenhang zwischen Wachstum und technischem Fortschritt stellt er historische Konstellationen wachstumsfördernder institutioneller Arrangements zur Seite.
Reinhard Selten hält die gesamten Grundannahmen der Mikroökonomie für vergleichsweise obsolet und verlangt eine Annäherung der Modellbildung an empirisch beobachtbare Verhaltensmuster. Der Homo Oeconomicus, der rationale Nutzenmaximierer ("Was ist überhaupt Nutzen?", fragt Selten), der als eine Art Yeti durch die ökonomische Theorie geistert, wird zu Grabe getragen.
Edmund S. Phelps, der über Zielkonflikte in der makroökonomischen Politik geforscht hat, fordert sein Fach auf, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die wirklich wesentlich sind - und hält einen Vortrag über den Zusammenhang von Ökonomie und gutem Leben unter Rückgriff auf die alten Griechen. Zwei Momente schälen sich in diesem Revisionsprozess heraus: die Hinwendung in Theorie- und Modellbildung zum Menschen, zum humanen Kern der Ökonomie und zur Wirklichkeit ökonomischer Verhältnisse und Beziehungen.
Und eine Renaissance starker Institutionen. "Wir stimmen darin überein, dass der Kapitalismus diverser Varianten der Regulierung bedarf, sonst würde er kaum funktionieren", erklärte etwa Edmund S. Phelps. Summa summarum ist das eine Rückkehr zur politischen Ökonomie. In diesem Feld finden Wissenschaftler wie Praktiker, die reale Menschen und ihre Bedürfnisse ins Zentrum rücken und die Ökonomie nicht als Selbstzweck, sondern als Fundament gesellschaftlichen Lebens denken, einen Bezugsrahmen, der weit über die verkürzte Standortdebatte hierzulande hinausweist.
DER POLITIKER IST SOUVERÄN_ Doch löst auch dieser Trend ein grundlegendes Problem nicht, vor das sich politische Entscheidungsträger immer wieder beim unverzichtbaren Rückgriff auf wissenschaftliche Erkenntnisse gestellt sehen, um sich der eigenen Entschlüsse zu vergewissern. Was tun, auf was vertrauen, wem glauben, wenn in der wissenschaftlichen Kontroverse ein Nobelpreisträger das eine und ein anderer das Gegenteil empfiehlt und wenn eine höhere Instanz zur Klärung wissenschaftsseitig nicht mehr zu Rate gezogen werden kann?
"Jeder Ansatz von Wirtschaftspolitik produziert Gewinner und Verlierer", erklärt Robert Solow. "Wir können uns eine lupenreine Politik zurechtreimen, von der niemand besonders profitiert und die niemanden schädigt. Aber dieses Denken ist nicht realistisch." Aufgabe der Wissenschaft sei es, festzustellen, warum und unter welchen Umständen die einen profitieren und die anderen verlieren. In der Verantwortung der Politik dagegen liege es zu entscheiden, was zu tun ist, um die Balance herzustellen.
Tatsächlich gehen von Lindau beunruhigende Signale für den Mainstream der öffentlichen Wirtschaftsdebatte in Deutschland aus. Zur Reichweite wissenschaftlicher Erkenntnisse als Entscheidungshilfe für die Politik befragt, offenbaren die Nobelpreisträger ungeniert genau jene Selbstzweifel, die so manchem ständigen Talkshowgast aus der dritten deutschen Ökonomen-Liga abgehen. "Es steht außer Frage, dass das, was wir wissen, noch immer völlig unbefriedigend ist, um substanziell politisch zu beraten", erklärt der kanadische Finanzmarkt-Theoretiker Myron Scholes.
Und sein Kollege Edmund S. Phelps bedauert: "Viele unserer Ideen können wir nicht testen. Geschichte ereignet sich nur einmal, sie wiederholt sich nicht unter kontrolliert variierten Bedingungen", erklärt er. So konnten die Preisträger auch heiter zustimmen, dass der Politik und anderen Institutionen dann nichts übrig bleibt, als aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Politikern - und auch Gewerkschaftern - steht in Informations- und Entscheidungsdilemmata das Recht zu, nach eigenen moralischen und ethischen Kriterien zu entscheiden, beim Mindestlohn beispielsweise - Nobelpreisträger hin, Nobelpreisträger her.