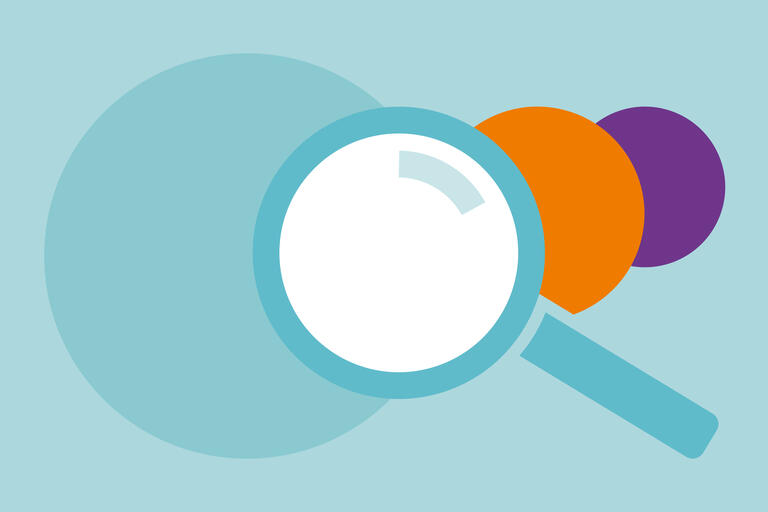: Politische Parallelwelten. Wo die Nichtwähler wohnen
DEMOKRATIE Die Wahlbeteiligung sinkt kontinuierlich. Vor allem Bürger in armen Stadtteilen ziehen sich von der Demokratie zurück. Von Armin Schäfer
ARMIN SCHÄFER ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln/Foto: picture alliance
Linksbündnis, Ampel oder große Koalition? Kaum war das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen bekannt, schon steht der Koalitionspoker im Brennpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit. Die Medien berichten genüsslich über Chaoten in der Linkspartei, Zerreißproben der FDP und Animositäten zwischen möglichen Koalitionspartnern. Dabei geriet schnell in Vergessenheit, dass mehr Menschen nicht gewählt hatten als CDU und SPD zusammen Stimmen bekommen haben. Mehr als 40 Prozent der Wahlberechtigten verweigerten sich der Stimmabgabe. Die Wahlbeteiligung war die zweitniedrigste aller Zeiten bei einer Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen.
Das war kein Ausrutscher. Seit inzwischen drei Jahrzehnten sinkt die Wahlbeteiligung. Nirgends wird heute das Niveau erreicht, das früher üblich war. Der Höhepunkt der Bereitschaft, wählen zu gehen, lag in den 70er Jahren (siehe Grafik Seite 54). Bei der Bundestagswahl 1972 gaben 91,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Seitdem fällt die Wahlbeteiligung bei allen Wahlen und in allen Bundesländern. Besonders gering ist die Wahlbereitschaft bei Europaparlaments- und Kommunalwahlen, hier liegt die Beteiligung häufig unter 50 Prozent. Doch auch Landtags- und Bundestagswahlen sind betroffen. Bei der Bundestagswahl 2009 wählten weniger Menschen als jemals zuvor.
Lange Zeit wurde die rückläufige Wahlbeteiligung in der Politikwissenschaft als Normalisierung gedeutet, da sie den 1970er Jahren ungewöhnlich hoch gewesen war. Doch inzwischen liegt die Wahlbeteiligung vielfach unter dem Niveau der 50er und 60er Jahre. Gelegentlich wird bezweifelt, ob eine hohe Wahlbeteiligung überhaupt wünschenswert ist, da sie bei der letzten Wahl in der Weimarer Republik besonders hoch gewesen war und insbesondere die NSDAP Nichtwähler mobilisieren konnte, wie der Politikwissenschaftler Jürgen Falter nachgewiesen hat. Vor diesem Hintergrund interpretierte Dieter Roth von der Forschungsgruppe Wahlen in den 90er Jahren eine mäßige Wahlbeteiligung als Ausdruck einer reifen politischen Kultur, die die Demokratie stabilisiert. Schließlich liegt die Wahlbeteiligung in einigen Ländern mit langer demokratischer Tradition wie den USA oder der Schweiz niedriger als in Deutschland. Sollten wir also den Einbruch der Wahlbeteiligung gelassen hinnehmen?
WER SIND DIE NICHTWÄHLER?_ Um das beantworten zu können, müssen wir wissen, wer die Nichtwähler sind. Inzwischen liegen über diese Gruppe einige Erkenntnisse vor. Neben "unechten" Nichtwählern, die beispielsweise ihre Briefwahlunterlagen zu spät abgeschickt haben oder wegen Krankheit nicht wählen gehen, finden sich unter ihnen Desinteressierte oder Enttäuschte. Häufig interessieren sich Nichtwähler weniger für Politik, glauben nicht, dass sie politische Entscheidungen beeinflussen können, und fühlen sich von den Parteien nicht repräsentiert. Daneben gibt es Wahlberechtigte mit enger Parteibindung, die jedoch von ihrer angestammten Partei enttäuscht sind, ohne eine andere wählen zu wollen. In den letzten Jahren hatte insbesondere die SPD damit zu kämpfen, dass ihre Anhänger der Wahlurne fernbleiben. Eine geschlossene "Partei der Nichtwähler" gibt es demnach nicht. Allerdings sollten die vielfältigen Motive der Nichtwahl nicht den Blick auf Regelmäßigkeiten versperren, die aus demokratischer Sicht alarmierend sind.
Die Demokratie baut auf dem Ideal politischer Gleichheit auf. Alle sozialen Schichten müssen dieselbe Chance haben, dass ihre Interessen berücksichtigt werden. Wenn wir uns jedoch die soziale und räumliche Konzentration der Nichtwähler anschauen, wachsen die Zweifel, ob dieses Ideal noch erreicht wird. Grafik 2 zeigt die Resultate von Umfragen, die zwischen 1980 bis 2006 gemacht wurden. Personen mit unterschiedlichem Einkommen sollten angeben, ob sie "sehr wahrscheinlich" oder "wahrscheinlich" wählen würden, wenn am nächsten Sonntag eine Wahl stattfände. Ende der 1970er Jahre lagen Befragte mit geringem Einkommen und solche mit hohem Einkommen nahezu gleichauf. Mehr als 90 Prozent beider Gruppen hatten die Absicht, zu wählen.
Seitdem hat sich für die Gruppe der Einkommensstarken wenig verändert. Ganz anders bei den Geringverdienern. Hier fand ein kontinuierlicher, sich beschleunigender Rückgang der Wahlabsicht statt. Die Kluft zwischen beiden Gruppen ist damit über die Jahre angewachsen. Dasselbe Muster zeigt sich, wenn man Menschen mit niedriger und hoher Bildung vergleicht. Bei der "Unterschicht" und Personen mit Hauptschulabschluss bricht die Wahlabsicht ein, während sie bei Oberschichtangehörigen und Personen mit Abitur stabil geblieben ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass Gutverdiener und Akademiker aus Parteien- und Politikverdrossenheit nicht zur Wahl gehen, ist also geringer.
Jüngere bleiben besonders häufig der Wahlurne fern: Bei der Bundestagswahl 2009 gaben nur 60 Prozent der unter 30-Jährigen ihre Stimme ab, während 80 Prozent der Wähler zwischen 60 und 70 Jahren gewählt haben. Doch diese allgemeine Aussage verdeckt Unterschiede. Aus Umfragen wissen wir, dass in allen Altersgruppen höher Gebildete häufiger angeben, gewählt zu haben. Den größten Einfluss auf die Wahlteilnahme hat der Bildungsgrad allerdings bei den Jüngeren. Abiturienten zeigen auch heute noch eine hohe Bereitschaft, zu wählen, während sie bei jungen Leuten ohne Schulabschluss oder mit Hauptschulabschluss deutlich niedriger liegt.
ARME UND REICHE STADTVIERTEL_ Auf Umfragedaten sollte man sich nicht ausschließlich verlassen, weil Befragte auch sozial erwünschte Antworten geben. Um besser zu verstehen, wer die Nichtwähler sind, lohnt daher ein Blick auf die Stadtviertel. Vor allem in Großstädten zeigen sich große Unterschiede. Denn die Wahlbeteiligung sinkt keineswegs überall. In gutsituierten Vierteln wie Hamburg-Blankenese oder Köln-Marienburg wählen weiterhin mehr als 80 Prozent der Wahlberechtigten. Von Wahlmüdigkeit keine Spur. Dasselbe gilt für alle Großstädte: In gehobenen Vororten und wohlhabenden Stadtbezirken verharrt die Wahlbeteiligung auf hohem Niveau. Ganz anders in sozialen Brennpunkten, die durch Arbeitslosigkeit und Armut geprägt sind. Hier finden sich regelmäßig die Negativrekorde bei der Wahlbeteiligung. In Köln-Chorweiler oder Berlin-Neukölln wählt selbst bei Bundestagswahlen nur noch jeder zweite, bei Kommunalwahlen jeder dritte und bei Europawahlen jeder vierte Wahlberechtigte. Nichtwähleranteile von 75 Prozent sind in diesen Stadtvierteln keine Seltenheit mehr. Auch wenn wir nicht immer wissen, wer die Nichtwähler sind - wo sie leben, das steht fest.
Unterschiede in der Wahlbeteiligung betreffen nicht nur arme und reiche Stadtviertel. Ein systematischer Zusammenhang zieht sich durch alle Stadtteile: Dort, wo die Arbeitslosenquote oder der Anteil der Arbeitslosengeld-II-Empfänger höher ist, ist die Wahlbeteiligung niedriger. Das kann man mit großer Sicherheit vorhersagen. Die dritte Grafik verdeutlicht diesen Zusammenhang am Beispiel Kölns. Auf der horizontalen Achse ist die Arbeitslosenquote, auf der vertikalen Achse die Wahlbeteiligung abgetragen. Bei Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen zeigt sich stets dasselbe Muster: Je höher die Arbeitslosigkeit, desto niedriger die Wahlbeteiligung. Zwar unterscheiden sich Wahlen im Niveau der Beteiligung, nicht aber in der Frage, wo die Beteiligung hoch und wo sie niedrig ist.
War das nicht immer schon so? Nein. Für Bremen liegen Daten zur Wahlbeteiligung in einzelnen Stadtteilen für fast vier Jahrzehnte vor. 1972 betrug der Unterschied zwischen der höchsten und der niedrigsten Wahlbeteiligung zehn Prozentpunkte. Seitdem ist der Abstand immer größer geworden. Bei der Bundestagswahl 2009 waren es 35 Prozentpunkte. Wie in Köln ist auch in den armen Bremer Stadtteilen die Wahlbeteiligung am niedrigsten. Dasselbe Muster zeigt sich in so unterschiedlichen Großstädten wie Dortmund, Dresden, Frankfurt, Hamburg, Leipzig oder Nürnberg.
Die Lebenswelt der Bewohner von Stadtteilen mit hoher und niedriger Wahlbeteiligung könnte kaum unterschiedlicher sein. Der erneute Blick auf Köln verdeutlicht dies. Vergleichen wir die zehn Kölner Stadtteile mit der höchsten mit den zehn Stadtteilen mit der niedrigsten Wahlbeteiligung, dann zeigt sich: Dort, wo die Wahlbeteiligung niedrig ist, ist die Quote alleinerziehender Frauen doppelt so hoch, der Migrantenanteil dreimal, die Arbeitslosenquote viermal, der Anteil der Bedarfsgemeinschaften fünfmal und der Anteil öffentlich geförderter Wohnungen zehnmal so hoch. Während in den ärmsten Stadtteilen nur jeder fünfte Jugendliche ein Gymnasium besucht, sind es in den reichsten Stadtteilen mehr als 80 Prozent. Angesichts dieser Unterschiede muss es nicht verwundern, dass viele Bürger in armen Stadtteilen von der Politik enttäuscht sind. Inzwischen wissen wir, dass Unzufriedenheit häufig zu Apathie und dem Verzicht auf politische Teilhabe, nicht aber zu Protest führt.
Wie wirkt sich die ungleiche Wahlbeteiligung in den Stadtteilen auf das Abschneiden der Parteien aus? Bei der Bundestagswahl 2009 gab es einen klaren Zusammenhang: CDU und insbesondere Grüne und FDP erzielen ihre besten Ergebnisse in Stadtteilen mit hoher Wahlbeteiligung. Linkspartei und SPD schneiden dort gut ab, wo die Wahlbeteiligung niedrig ist. Falls man davon ausgeht, dass Wähler und Nichtwähler in einem Stadtteil ähnliche Parteipräferenzen haben, heißt das, dass insbesondere linke Parteien mögliche Wähler nicht mehr erreichen. Auch der Linkspartei gelingt keine Mobilisierung. Sowohl bei der Bundestagswahl 2009 als auch bei der NRW-Landtagswahl verlor die Linke mehr ehemalige Wähler an die Nichtwähler als sie ihrerseits Nichtwähler gewann. Ihre Erfolge gehen darauf zurück, Wähler anderer Parteien abzuwerben.
WAS TUN?_ Die Muster der Nichtwahl werfen Fragen für die Demokratie auf. Wer repräsentiert die Menschen in Nichtwählerhochburgen, wenn zwei Drittel der Wahlurne fernbleiben? Wird politische Teilhabe zunehmend das Privileg der Bessergestellten?
Die Gefahr einer niedrigen und gleichzeitig ungleichen Wahlbeteiligung liegt darin, dass sich die Politik an wahlrelevanten und konfliktfähigen Gruppen orientiert und die Anliegen der sozial Schwachen übergeht.
Um mehr Menschen wieder zur Wahl zu animieren, könnte man bei den Parteien ansetzen. Einige schlagen vor, die Wahlbeteiligung an die Parteifinanzen zu koppeln, sodass ein Anreiz besteht, Wähler zu mobilisieren. Andererseits könnte man Wahltermine zusammenlegen, denn wenn eine Landtagswahl am selben Tag wie die Bundestagswahl stattfindet, liegt die Wahlbeteiligung deutlich höher. Auch über eine Wahlpflicht lässt sich diskutieren. Häufig wird zudem angeregt, Elemente direkter Demokratie einzuführen, um den Bürgern unmittelbares politisches Mitspracherecht einzuräumen. Mit einer neuen Idee wartete der Europarat auf; danach sollten Wähler bei der Stimmabgabe ein Los erhalten, und die Lotteriegewinner sollten über einen Teil der öffentlichen Ausgaben mitbestimmen dürfen.
Mit diesen Reformideen soll das Wählen attraktiver werden. Dagegen ist nichts einzuwenden, doch greifen solche Maßnahmen zu kurz. Möchte eine Gesellschaft den Ursachen einer sinkenden Wahlbeteiligung begegnen, muss sie sicherstellen, dass die soziale Ungleichheit nicht ausufert. In den Nichtwählerhochburgen sind die Menschen perspektiv- und chancenlos. Dies führt zu Politikferne. Und Politikferne führt zu Wahlenthaltung.