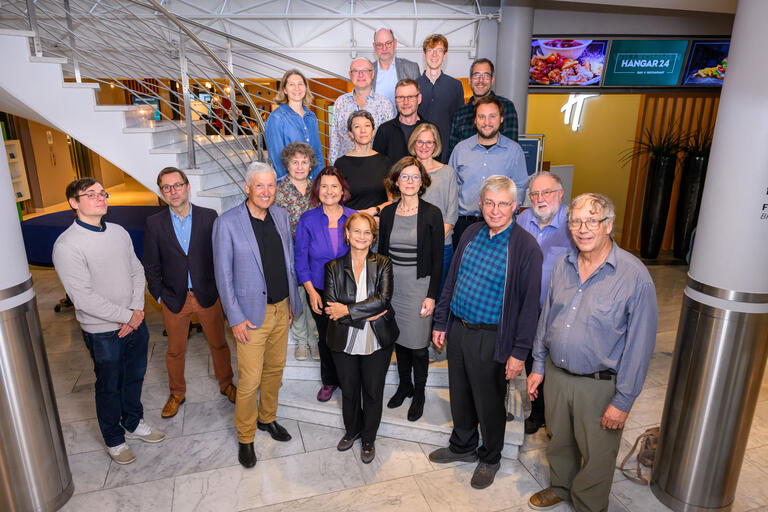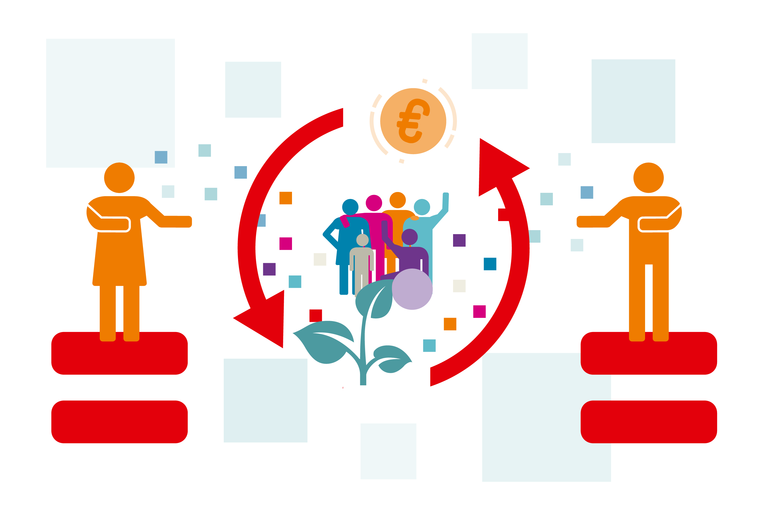Tagungsbericht FMM-Konferenz: Warum die Wirtschaft eine Care-Brille braucht
Das Forum for Macroeconomics and Macroeconomic Policies (FMM) trug in diesem Jahr den Titel „Gendering Macroeconomics“. Mehr als 300 Wissenschaftler*innen debattierten über Care-Arbeit als zentralem Baustein der Wirtschaft.
[05.11.2025]
Von Jeannette Goddar
Diane Elson braucht nur wenige Sätze, um das gängige Narrativ in Frage zu stellen. „Die Ökonomie behandelt Arbeit, als käme sie aus dem Nichts“, sagt die emeritierte Professorin aus Großbritannien. Dabei sei Arbeit ein „produziertes Produktionsmittel“ – ohne Sorgearbeit, Pflege, Zeit und Zuwendung gibt es keine Arbeitskräfte. All das bleibe in Wirtschaftsmodellen gemeinhin unsichtbar. Die Nichtbeachtung unbezahlter Sorge- und Reproduktionsarbeit bezeichnete die britische Ökonomin als „systematischen blinden Fleck“ mit fatalen Folgen. Denn wenn die öffentliche Hand spart, wie in Zeiten der Austeritätspolitik üblich, dann oft zuerst an der bezahlten Care-Arbeit; in Kitas, an Schulen oder in der Pflege. „Damit landet auch diese Arbeit vor allem auf den Schultern von Frauen“, erläuterte Elson. Die Folge: eine „Erschöpfung menschlicher Fähigkeiten – und Stress, Krankheit und sinkende Bildungschancen, die langfristig die Produktivität der gesamten Volkswirtschaft untergraben.
Doch wie gelingt es, bezahlte wie unbezahlte Sorgearbeit sichtbar zu machen? Das war eine der zentralen Fragen der diesjährigen FMM-Konferenz des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. Im Zentrum der dreitägigen Debatten stand durchaus auch Nabelschau – nämlich die Frage, warum selbst Ökonom*innen jenseits des Mainstreams sich damit schwertun, Wirtschaft unter einer „Care-Brille“ zu betrachten. So fragte Özlem Onaran von der Universität Greenwich und eine der 19 FMM-Koordinator*innen: „Warum ignorieren selbst viele postkeynesianische Ökonom*innen das Thema Geschlecht, während sie Klassenunterschiede als selbstverständliche Analysekategorie nutzen?“ Zugleich war man sich einig, dass es neue ökonomische Modelle braucht, um zu überfälligen politischen Reformen zu kommen: „Was wir nicht modellieren, bleibt unsichtbar. Was unsichtbar bleibt, wird nicht gesehen – und was nicht gesehen wird, wird nicht politisch“, so Elissa Braunstein von der Colorado State University.
Blinde Flecken der Ökonomie aufdecken
Über 300 Wissenschaftler*innen, unter ihnen zahlreiche Pionierinnen der feministischen Ökonomie, der Politik und den Wirtschaftswissenschaften, brachten genug Stoff mit, um die blinden Flecken der herkömmlichen Ökonomie aufzudecken und eine Politik zu gestalten, die Ungleichheit in all ihren Dimensionen – Geschlecht, Klasse und deren Überschneidungen – ernst nimmt. Mehr als 150 Präsentationen befassten sich mit der Frage, wie Wirtschaft und Wirtschaftspolitik aussehen kann, wenn man sie konsequent durch eine feministische Linse betrachtet. Das übergreifende Fazit: Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts lassen sich nicht ohne Care-Linse beantworten und Wirtschaftspolitik, die unbezahlte Sorgearbeit ausblendet, ruiniert ihre eigene Grundlage.
Özlem Onaran legte dar, dass sich Investitionen in soziale Infrastruktur auch ökonomisch lohnen. Öffentliche Ausgaben für Kinderbetreuung, Bildung und Pflege haben in ihren Modellen deutlich höhere Wachstums- und Beschäftigungseffekte als klassische Investitionen etwa in die Bauwirtschaft. Zum einen werden direkt Arbeitsplätze geschaffen, überwiegend für Frauen; zum anderen ist eine gesündere und besser ausgebildete Bevölkerung leistungsfähiger und produktiver. „Wer in Care investiert, kann auch die Arbeitsmarktteilnahme erhöhen“, sagte Onaran. In vielen Fällen seien die Investitionen teilweise oder vollständig selbstfinanzierend, weil steigende Steuereinnahmen und sinkende Sozialausgaben die anfänglichen Kosten kompensieren.
16,5 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit
İpek İlkkaracan von der Technischen Universität Istanbul lenkte den Blick auf die globale Dimension: Weltweit würden täglich rund 16,5 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit geleistet. Verlagerte man nur die Hälfte in den bezahlten Bereich, könnten Hunderte Millionen neuer Jobs entstehen. İlkkaracan ging aber noch einen entscheidenden Schritt weiter und verband die Care-Ökonomie mit der Stabilität politischer Systeme. Eine starke Care-Infrastruktur könne demokratische Resilienz stärken und für eine nachhaltigere Zukunft sorgen. Die türkische Ökonomin stellte ihr Konzept einer „Purple Economy“ vor, das Care-Arbeit und Umweltpolitik verbindet: „Lila Jobs sind auch grüne Jobs. Sie sind lokal, emissionsarm und gesellschaftlich unverzichtbar.“
Das Dreieck aus Geschlecht, Vermögen und Klima beleuchtete Miriam Rehm von der Universität Duisburg-Essen. „Nirgends ist der Gender Wealth Gap größer als bei den Top-Vermögenden. Wer Wohlstand hat, besitzt auch die Entscheidungsmacht“, konstatierte Rehm. Diese Machtkonzentration sei direkt mit der Klimakrise verknüpft, da dieselbe Gruppe Menschen zugleich für einen großen Löwenanteil der CO2-Emissionen verantwortlich ist. „Meine These ist, dass auch die sozial-ökologische Transformation nicht ohne eine Neuverteilung von Arbeit und Care gelingen wird“, erläuterte Rehm. Und auch wenn sie eine visionäre politische Führung, die Umverteilung selbstbewusst angeht, zurzeit für nicht sehr wahrscheinlich hält, gelte: „Wir wissen, dass es dafür gesellschaftliche Mehrheiten gibt, ebenso wie für den Klimaschutz. Es ist möglich.“
Globaler Süden in der doppelten Zwickmühle
Investitionen, auch wenn sie sich irgendwann einmal rechnen, kosten zunächst Geld – es braucht also Steuereinnahmen. Für den globalen Süden diagnostizierte Caren Grown, langjährige Direktorin für Genderfragen der Weltbank, eine „doppelte Zwickmühle“: Entwicklungshilfe geht zurück, gleichzeitig drohen neue Handelshemmnisse. Grown forderte ein „Steuerjahrzehnt für die Entwicklung“, in dem progressive Einkommensteuern gestärkt und Kapital wie Unternehmen stärker besteuert werden. Gleichzeitig warnte sie davor, sich in Einzelmaßnahmen wie der Mehrwertsteuersenkung auf Tampons und Binden zu verlieren. Solche Ausnahmen begünstigten oft Wohlhabende oder Händler. Ihre Empfehlung: die Steuerbasis breit halten, und das Geld auf der Ausgabenseite gezielt unter anderem Frauen und Mädchen zugutekommen zu lassen. „Nur wenn Menschen den Staat als Partner erleben, der öffentliche Güter liefert – von Pflege bis Klimaschutz –, wächst die Bereitschaft, Steuern zu zahlen“.
Margit Schratzenstaller vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) nahm unter anderen das deutsche Steuersystem unter die Lupe. Das Ehegattensplitting sei kein Ausdruck von Familienfreundlichkeit, sondern halte Frauen vom Arbeitsmarkt fern: „Das ist nicht nur ungerecht, es ist volkswirtschaftlich schädlich.“ Auch die Mehrwertsteuer sei geschlechtsblind konstruiert: „Eine hohe Steuer auf Grundnahrungsmittel oder Kinderkleidung ist de facto eine Steuer auf Sorgearbeit“. Die Austeritätspolitik in vielen EU-Ländern nach den Krisenjahren treffe Frauen ebenfalls doppelt: Nicht nur steige der Druck auf die unbezahlte Sorgearbeit. Auch Kürzungen im Sozialschutz träfen Frauen überproportional, da sie häufiger armutsgefährdet sind, und Kürzungen bei Gleichstellungsmaßnahmen untergrüben die institutionelle Verankerung von Frauenrechten.
Forschen, um politische Entscheidungen zu beeinflussen
Elissa Braunstein skizzierte die zentralen Herausforderungen bei der Integration von Care in makroökonomische Modelle: Das Bruttoinlandsprodukt dürfe nicht länger als Ziel, sondern als Mittel zum Zweck menschlicher Entwicklung verstanden werden. Ausgaben für Gesundheit und Bildung seien keine Konsumausgaben, sondern Investitionen. Die Qualität von Sorgearbeit müsse, obwohl sie sich nicht wie bei Industriegütern standardisieren lasse, abgebildet werden. Wenn all das gelingt, traut Braunstein Modellen eine regelrecht „revolutionäre Kraft“ zu – vorausgesetzt, sie werden veröffentlicht, erklärt und wirksam. Denn: „Natürlich forschen wir, um politische Entscheidungen zu beeinflussen und Veränderungen in Institutionen, Regierungen und Ländern herbeizuführen“, ergänzte Caren Grown.
Und so endete die 29. FMM-Konferenz, das wie in jedem Jahr Forscher*innen verschiedener makroökonomischer Denkschulen sowie von mehreren Kontinenten zusammenbrachte, mit einem klaren Appell: Feministische Makroökonomie ist keine Nische, sondern der Kern einer realistischen Wirtschaftspolitik. Sie bietet einen Fahrplan für eine Wirtschaft, die nicht auf Kosten von Frauen, zukünftigen Generationen und des Planeten wächst, sondern in ihre Grundlagen investiert: Sorge, Bildung und eine intakte Umwelt. Oder auch: Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts lassen sich nicht ohne Care-Linse beantworten.