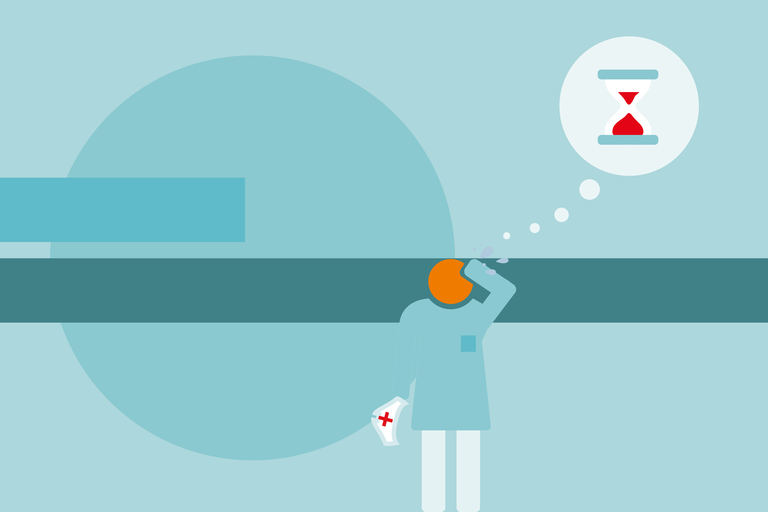Menschen: Heldinnen und Helden in der Krise
Während des Shutdown schälte sich heraus, wer und was wirklich wichtig ist: die Verkäuferin, die jeden Tag hinter der Kasse sitzt. Die Lkw-Fahrerin, die trotz Reisewarnung durch Europa fährt, der Arzt und die Pflegerin, die sich weiter um kranke Menschen kümmern. Sechs Menschen erzählen von ihrem Alltag – und wie sie die Wochen des Stillstands erlebten. Von Jeannette Goddar und Andreas Schulte
"Es musste eine Lösung her"
Stefan Karakaya, Hausarzt in Berlin-Neukölln: Seit vier Jahren arbeite ich als Hausarzt in Berlin-Neukölln. Dass sich durch Corona vieles ändern würde, war mir früh klar. „So, ab sofort tragen wir alle Mundschutz“, sagte ich eines Morgens im März in der Praxis. Zunächst haben wir versucht, Menschen mit Verdacht auf eine Covid-19-Infektion innerhalb unserer Räume von den übrigen Patienten zu trennen. Das war, wie in vielen Praxen, allerdings nicht möglich. Als wenig später Kollegen berichteten, das Gesundheitsamt habe ihre Praxen schließen wollen, nachdem sie positiv Getestete in ihren Räumen hatten, war klar: Es muss eine andere Lösung her. Wir wollten ja weiterhin für all unsere Patienten bereitstehen. Zuerst haben wir mit Abstrichen durch das geöffnete Fenster experimentiert. Das brachte alle Beteiligten in eine unangenehme Lage: Die Leute standen mitten in Neukölln auf der Straße; ich wiederum konnte sie nicht untersuchen, was mir als Arzt natürlich ein Anliegen ist.
Schließlich habe ich den alten Wohnwagen der Familie vor die Praxis gestellt, ein bewährtes, aber ausrangiertes Frankreichurlaubsmobil. Den damals noch geöffneten Restaurants in der Straße war das allerdings nicht recht, auch die Mitarbeiter des Ordnungsamts waren schnell zur Stelle. Meine Versuche, den Camper, dessen TÜV abgelaufen ist, legal auf Straßengelände abzustellen, verliefen trotz mehrerer Anrufe im Bezirksamt im Sande. Inzwischen ist er stillschweigend geduldet. Auf diese Weise haben wir, jedenfalls solange das Wetter gut ist, einen pragmatischen Weg gefunden. Patienten mit Covid-19-Verdacht melden sich zu einer festen Zeit am Fenster unserer Praxis. Ich gehe dann in den Wohnwagen und lege eine Schutzausrüstung an, mit der ich die Praxisräume nie betrete. Die Schutzkleidung haben wir uns auf verschiedenen Wegen teils über private Kontakte über Wochen notdürftig besorgen können. Kurz vor Ostern kam schließlich ein lang angekündigtes Paket der Kassenärztlichen Vereinigung.
Insgesamt lässt sich aus der Krise viel lernen. Die ersten Handlungsanweisungen vom Robert-Koch-Institut waren beispielsweise wenig sinnvoll. Darin hieß es, jeder Verdachtsfall solle, in einen kompletten Schutzanzug verpackt, mit dem Notarzt sofort in ein Krankenhaus gebracht werden. Das hätte die Kliniken auf der Stelle überlastet. Besser wäre es, das ambulante Testwesen deutlich zu professionalisieren. Auch für den anstehenden Umzug unserer Praxis ziehen wir unsere Lehren: Wenn es sich einrichten lässt, werden wir dort klar voneinander trennbare Bereiche schaffen.
"Fast alle arbeiten an eigenen Smartphones"
Friedo Scharf, Lehrer in Berlin-Kreuzberg: Als die Schulen schlossen, hat uns das kaum überrascht. Unsere Partnerschule war schon zu; dort hatte es nach einer Skireise Corona-Fälle gegeben. Wir fragten uns eher, wie gefährdet wir nun sind. Dennoch ging alles super schnell: Die Schülerinnen und Schüler kamen noch einmal, nahmen Materialien mit oder fotografierten sie ab. Dabei haben wir immerhin noch besprochen, wie wir nun Kontakt halten. Zugute kam uns, dass wir in der digitalen Welt schon angekommen waren. Die siebte und achte Klasse, die ich leite, kann Messenger-Dienste nutzen und ist auch imstande, den Eltern das zu erklären. Es half auch, dass unsere Schülerinnen und Schüler schon zuvor sehr selbstständig lernten. Die größte Herausforderung war, ein digitales Logbuch aufzustellen, in das sie ihre Lernfortschritte eintragen. Das hatten sie zuvor auf Papier gemacht.
Zu Hause arbeiten die Jugendlichen nun fast alle an ihren Smartphones. Computer oder Tablet hat fast niemand. Damit kommen wir zum größten Problem. Im Grunde stellen wir zurzeit fest: Internet ist ein Menschenrecht und muss so behandelt werden. Schulen wie Schülern müsste eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden; zurzeit richte ich fürs WLAN in der Schule zum Beispiel noch einen privaten Hotspot ein. Zum anderen fehlt es an flächendeckenden Konzepten, die erarbeitet, erprobt und durch Fortbildung der Lehrkräfte verbreitet werden. Ich hoffe, dass die derzeitige Krise wenigstens in dieser Hinsicht zu etwas Positivem führt.
Für unseren digitalen Unterricht haben wir uns gegen die Variante entschieden, uns alle um acht Uhr früh vor unseren Geräten zu versammeln. Wir Lehrkräfte stellen jeden Morgen eine „Daily Challenge“ online und bitten die Schüler, ihr Ergebnis zu posten. Außerdem muss jeder Schüler uns bis zehn Uhr geschrieben haben, was er oder sie sich für den Tag vornimmt. Bis am späten Nachmittag stehen wir dann für Feedback bereit.
Zum Glück sind wir auch mit den Eltern gut vernetzt via Messenger-Dienst, Telefon, Video. So konnten wir allen mitteilen, dass wir in den zurückliegenden Osterferien auch für nichtschulische Fragen erreichbar sind. Viele Schüler leben in sehr kleinen Wohnungen, teils mit vielen Geschwistern. Es wäre überraschend, wenn es nicht zu Konflikten kommt. Das ist meine größte Sorge: dass zu Hause etwas passiert, in das wir keinen Einblick haben, und Schüler uns wegrutschen. Mit der Schule fehlt nicht nur ein Lernort, sondern auch ein sozialer Raum. Und ein wirklicher Austausch, übrigens auch unter Kollegen, kommt online zu kurz.
"Wir sind ganz schön einsame Helden"
Christina Scheib, Lkw-Fahrerin: Ich bin selbstständig und pendle mit meinem Lkw, mit Lebensmitteln beladen, hauptsächlich zwischen Deutschland und Italien. Lkw-Fahrer werden jetzt mehr gebraucht denn je. Ich will da helfen. Aber die Corona-Krise bedeutet für mich und die Branche Einbußen. Vielen unserer Auftraggeber geht es schlechter als sonst. Das verstärkt den Druck auf die Frachtpreise, die ohnehin im Keller sind. Wir müssen für immer weniger Geld fahren.
Solidarität unter den Fahrern erlebt man längst nicht überall. Zum wirtschaftlichen Druck kommt eine unsichere Informationslage. Manche Kollegen halten sich an alle Hygieneregeln, andere begrüßen sich per Handschlag, als gebe es Corona nicht. In den sozialen Netzwerken entlädt sich die Spannung. Dort greifen sich Kollegen untereinander an. Dabei wäre Zusammenhalt so wichtig. Ich würde mir wünschen, dass jeder ein bisschen mehr Verständnis für den anderen aufbringt.
In unserem Alltag auf der Autobahn ist einiges schwieriger geworden: Die Raststätten sind geschlossen. An den Grenzen wird kontrolliert. Es wird Fieber gemessen, wir müssen mehr Papierkram erledigen. Das kostet Zeit. Wenn wir an der Rampe unsere Waren anliefern, dürfen wir nicht selbst abladen. Das erledigen nun Mitarbeiter beim Discounter. Wir wissen nicht, ob auf der Ladefläche alles ordnungsgemäß ausgeführt wird, weil wir vorne in der Kabine sitzen bleiben müssen. So geht auch der Kontakt zu den Menschen verloren. Wenn also jetzt gesagt wird, wir seien „Helden des Alltags“, so muss man auch sagen, dass wir ganz schön einsame Helden sind.
Überhaupt ist dieser ganze Hype um manche Berufe in den Medien völlig übertrieben. Natürlich fühlt es sich gut an, wenn man über die Autobahn fährt, und oben auf der Brücke klatschen die Leute. Aber letztlich machen wir unseren Job doch wie sonst auch, und dann klatscht keiner. Im Gegenteil: In normalen Zeiten werden wir manchmal behandelt wie Aussätzige. Wir haben in Raststätten zum Beispiel kaum saubere Duschen. Es gibt viel zu wenige Parkplätze, und andere Autofahrer bremsen uns immer wieder aus. Insgesamt müssten Politik und Kontrollbehörden konsequenter gegen Dumpingpraktiken auf dem Transportmarkt vorgehen.
Meinen Beruf mache ich trotzdem gerne. Es wird nie eintönig, man weiß nie, was als Nächstes passiert. Derzeit ist mein Lkw in Reparatur, aber es kann immer sein, dass ich auch nachts einen Anruf bekomme und dann sofort losfahren muss. Das kommt mir entgegen, denn bei allem, was ich tue, gebe ich 120 Prozent.
"Die Angst fährt mit"
Markus Kowollik, Busfahrer in Halle: Erst als das Virus in Italien ankam, wurde mir so richtig bewusst, dass es auch uns bald erreichen würde. Da bekam ich es schon mit der Angst zu tun. Die Angst fährt seither immer mit im Bus. Mir war aber trotzdem von vornherein klar: Ich werde weiterfahren. Die Menschen haben ein Recht auf Beförderung. Viele von ihnen haben den Nahverkehr bisher als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Vielleicht führt die Krise ihnen vor Augen, dass dies nicht so ist. Das würde ich mir wünschen.
Für uns Fahrer ist nun nur noch weniges selbstverständlich. Vieles hat sich geändert. Mein Arbeitgeber, die Hallesche Verkehrs AG, hat zum Glück schnell auf das Virus reagiert. Der Vordereinstieg der Busse wurde gesperrt, und man hat uns Fahrern eine Kabine aus Plastikplane mit einem kleinen Fenster zum Fahrgastraum gebaut.
Trotz der Ansteckungsgefahr helfe ich den Fahrgästen, wenn sie zum Beispiel mit dem Ticketautomaten Probleme haben. Natürlich wahre ich den Sicherheitsabstand. Auf diese Änderungen stellt man sich ein. Manche fordern eine Kabine auch für die Zeit nach Corona – wie bei Straßenbahnen. Aber ich bin dagegen, weil ich die Nähe zu den Fahrgästen mag. Im Moment muss ich darauf natürlich verzichten.
Auch im Umgang mit den Kollegen hat sich einiges geändert. Wir wahren alle den Sicherheitsabstand. Aber es fällt nach 30 Berufsjahren schon schwer, etwa auf Umarmungen mit befreundeten Kollegen zu verzichten. Insgesamt merkt man bei uns Fahrern die Verunsicherung bei der Einschätzung der Lage. Einige bezweifeln die Gefährlichkeit des Virus, das geht hin bis zu Verschwörungstheorien. Diese Kollegen tragen die neuen Schutzmasken daher nur schweren Herzens. Anderen gehen die allgemeinen Einschränkungen hingegen nicht weit genug. Da haben wir die ganze Bandbreite an Meinungen.
Von einem möglicherweise erhöhten Krankenstand durch Corona oder durch die vereinfachte Krankschreibung weiß ich nichts. In unserem Notfahrplan fallen jedenfalls keine Touren aus. Wir fahren nur noch gut zwei Drittel der üblichen Fahrten, denn die Fahrgastzahlen sind eingebrochen.
Trotzdem kommen wir als städtische Angestellte in der Krise noch vergleichsweise gut weg. Unser Unternehmen hat auf Kurzarbeit verzichtet. Wäre es anders gekommen, hätte das viele Kollegen mit Familien hart getroffen. Die Minderarbeit wird bei uns über Arbeitszeitkonten geregelt. Allerdings liegt meine begonnene Ausbildung zum Straßenbahnfahrer erst einmal auf Eis.
Ich habe jetzt Urlaub und langweile mich zu Tode. Man kann ja nicht verreisen. Ich sitze viel auf dem Balkon und informiere mich über die Lage. Manchmal besuche ich meine 80-jährige Mutter. Sie sieht ein, dass es zu riskant wäre, wenn ich ihr Haus betrete. Deshalb steht sie bei meinen Besuchen auf ihrem Balkon und ich unten. Ich freue mich auf den Arbeitsbeginn nächste Woche. Aber, wie gesagt: Die Angst fährt mit.
"Ständig laufen wir der Mitbestimmung hinterher"
Bettina Rödig, Kinderkrankenpflegerin und Betriebsrätin in München: In unserem Krankenhaus gab es nicht ganz zufällig die ersten Covid-19-Fälle; von fünf Münchener Kliniken ist es bei Pandemien die erste Anlaufstelle. Als im Februar Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto aufgenommen wurden, fuhr die Leitung die Intensivkapazitäten hoch und schichtete Personal um. Wenn von der Zahl der Intensivbetten und Beatmungsgeräte die Rede ist, führt das ja in die Irre: Entscheidend sind die Fachkräfte, und da zeigen sich aktuell die Auswirkungen einer jahrelangen Sparpolitik besonders deutlich: In der Kinderintensivmedizin werden seit Jahren Münchner Patienten nach Murnau oder Salzburg geflogen, weil bei uns Betten – also Fachkräfte – fehlen.
Ich arbeite üblicherweise in der Kinder- und Jugendpsychosomatik, in der wir zum Beispiel Essstörungen oder Depressionen behandeln. Die ist nun geschlossen, weil sie als nicht systemrelevant gilt. Seit März bin ich innerhalb der Kinder- und Jugendklinik auf der Intermediate-Care-Station tätig, einer Art Vorstufe zur Intensivstation. Zunächst bin ich bis Ende Juni versetzt.
Immerhin wurde ich gefragt, ob ich auf diese Station möchte. Häufig ist das nicht so. Wir Betriebsräte laufen seit Beginn der Corona-Krise der Mitbestimmung hinterher: weil Leute nicht dort arbeiten wollen, wohin sie versetzt wurden, weil es an Schutzausrüstung fehlt oder weil sie – das gelockerte Arbeitszeitgesetz macht das möglich – in Zwölf-Stunden-Schichten arbeiten sollen. Wer zwölf Stunden unter einer FFP3-Maske gegen einen Filter atmet, ist völlig fertig. Die Konzentration nimmt ab, die Fehlerquote nimmt zu, das Eigeninfektionsrisiko steigt. Weil krisenbedingt auch das Katastrophen- und das Infektionsschutzgesetz geändert wurden, gilt es nun jede Menge Neuregelungen zu beachten. Auch das ist wirklich krass.
Den Applaus für Pflegekräfte sehe ich zwiespältig. Einerseits hoffe ich, dass vielen endlich bewusst wird, was diese Leute leisten. Andererseits kämpfen wir seit Jahren um bessere Bedingungen. Jedem könnte längst klar sein, dass eine angemessene Versorgung aktuell gar nicht möglich ist. Insofern wäre Unterstützung schön gewesen, bevor die Menschen sich in einer existenziellen Bedrohungslage fühlen. Den Hinweis, dass mehr Engagement gut wäre, würde ich auch an den eigenen Berufsstand richten. Wenn sich mehr Pflegende aktiv für ihre Rechte und erträgliche Arbeitsbedingungen einsetzten, würde das sicher helfen.
"Plötzlich steht man im Mittelpunkt"
Edgar Fischer, Haustechniker in Gelsenkirchen: Im Marktkauf in Gelsenkirchen regle ich morgens die Einlasskontrolle. Eigentlich bin ich als Haustechniker beschäftigt und Betriebsrat. Den Dienst an der Tür mache ich freiwillig. Ich habe zwar Respekt vor dieser Aufgabe, aber keine Angst, mich anzustecken. Ich mache einfach, was notwendig ist. Auf diesem Standpunkt stehe ich sonst auch.
Zu Beginn der Krise wusste ich manchmal gar nicht, welchen Hut ich aufhabe, so vielfältig wurden plötzlich die Aufgaben. Bin ich Haustechniker, Betriebsrat, Einlasskontrolleur oder einfach Kollege? Es gab Unmengen an Informationen, aber leider auch genauso viel Unsicherheit. Kollegen und Kolleginnen, aber auch Kunden kamen auf mich zu: Stecke ich mich an, wenn jemand niest, woher bekomme ich Schutzkleidung, was ist überhaupt Corona …? Auch das Ordnungsamt will seine Auflagen an den Arbeitsschutz erfüllt sehen. Ohne es zu wollen, steht man plötzlich im Mittelpunkt.
Absolut chaotisch waren die Hamsterkäufe. Da hat man bei so manchem Kunden die Panik in den Augen gesehen. Auf dem Parkplatz ist ein Mopedfahrer umgekippt, weil er sein Gefährt mit Unmengen Klopapier beladen hatte. Von solchen Überreaktionen lasse ich mich nicht anstecken. An der Einlasskontrolle geht es teilweise noch immer aggressiv zu, aber zu Gewalt ist es noch nicht gekommen. Diskussionen sind hingegen Alltag, zum Beispiel weil Kunden nicht einsehen, dass sie wegen der Abstandsregeln einen Einkaufswagen mit in den Markt nehmen müssen. Mittlerweile ist es ruhiger geworden, aber wenn es einmal zu Diskussionen kommt, sind die nun heftiger. Kürzlich musste sich eine Kollegin ein „Leck mich am Arsch“ anhören.
Doch es gibt auch gute Seiten. Als Belegschaft erhalten wir viel Dankbarkeit. Beispielsweise hat eine Nachbarin von mir für uns gut 50 Schutzmasken genäht. Und auch unter den Kollegen sehe ich eine positive Entwicklung: Corona verstärkt die Solidarität. Wir passen besser aufeinander auf als zuvor. Gerade heute wurde mir das wieder bewusst. Ich hatte sehr schlecht geschlafen, und tatsächlich bemerkte ein Kollege im Markt dies und fragte mich: „Fehlt dir was? Du siehst ein bisschen schlecht aus heute.“ Genau diese Art der Achtsamkeit ist in der Corona-Zeit wichtig. Deshalb begrüße ich jeden Kunden, selbst wenn nicht immer etwas zurückkommt. Ich will jedem das Zeichen geben: Du bist nicht allein. Das lebe ich.
Mittlerweile hat sich bei Belegschaft und Kunden eine gewisse Gewöhnung eingestellt. Das sieht man auch an den Schutzmasken, die immer häufiger als Accessoire verstanden werden. Kürzlich kam ein Mädchen mit Mundschutz herein. Kinder müssen gar keine Maske tragen, aber sie wollte es, weil sie ihre, mit einem rosa Einhorn darauf, so schön fand. Dennoch: Ich brauche so eine Krise kein zweites Mal.