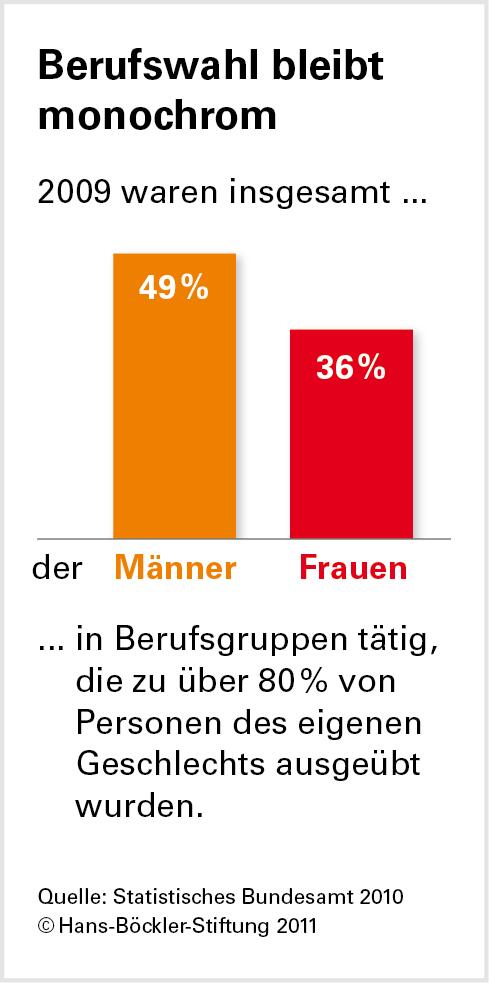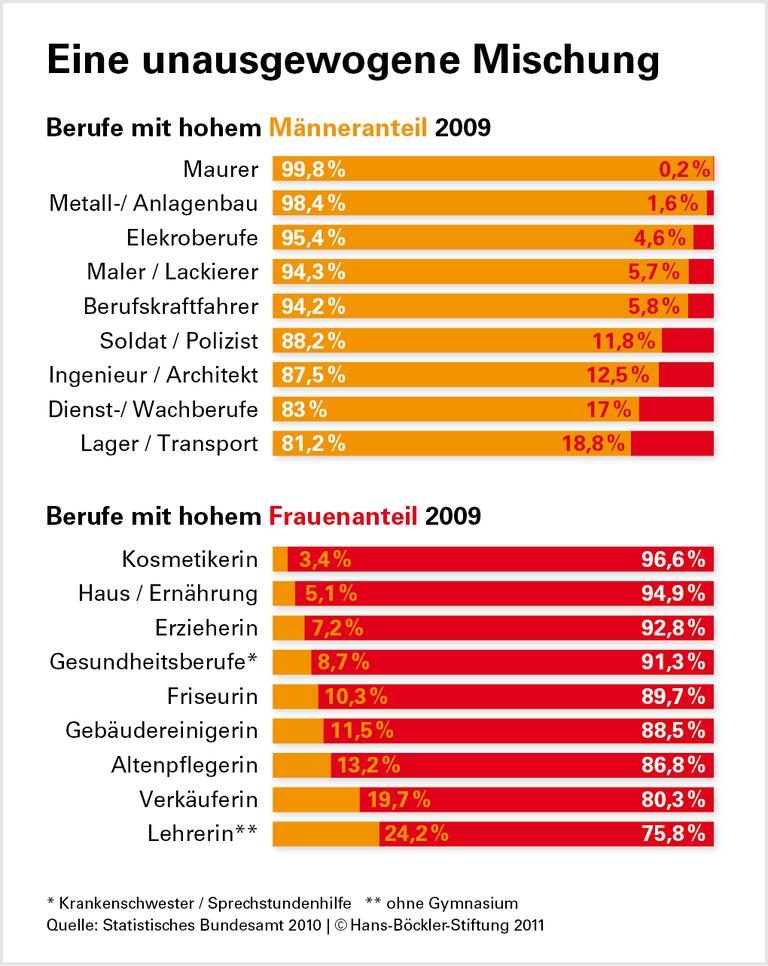Gender: Die Sache mit dem Einparken: Hirnforschung jenseits von Rollenklischees
Die moderne Hirnforschung sieht mögliche Begabungen von Frauen und Männern nicht mehr als biologisch vorgegeben und damit unveränderbar an. Viele Studien stellen noch nicht einmal Geschlechterdifferenzen fest.
„Seit mehr als 100 Jahren werden Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Gehirn gesucht – und angeblich gefunden“, so Sigrid Schmitz. Scheinbar natürliche Begabungen von Frauen für Sprache oder von Männern für Mathematik sollen die Eignung für bestimmte Berufsfelder erklären. Doch die Befundlage ist sehr widersprüchlich, stellt die Biologin und Professorin für Gender Studies an der Universität Wien fest. Während ihres Vortrags auf der diesjährigen Gleichstellungstagung der Hans-Böckler-Stiftung* zeigte sie auf: Auch die Naturwissenschaften gewinnen ihre Erkenntnisse nicht völlig wertfrei. Gesellschaftliche Vorstellungen über die Geschlechter beeinflussen ihre Arbeitsweisen, Methoden und Interpretationsvorgänge.
Die Hirnforschung hat sich in jüngerer Zeit als Leitwissenschaft herausgebildet, weil sie mit neuen Verfahren wie der Computertomografie den Blick ins lebende Gehirn verspricht. Damit habe sie den Anspruch, komplexe Phänomene mit neutralen technischen Verfahren sichtbar zu machen, erläutert die Professorin. Doch gehen den vermeintlichen Abbildern des Gehirns immer Entscheidungen voraus: Was kommt ins Bild und was nicht, was wird hervorgehoben, was tritt in den Hintergrund? Damit handele es sich nicht um abbildende Verfahren, sondern um Konstruktionen, so Schmitz. Sie erläutert dies anhand einiger Beispiele:
Sprache. Hier gelten Frauen als erfolgreicher. Einige Untersuchungen ergaben, dass Reime oder der Wortfluss bei Frauen schneller funktionieren. Ein Erklärungsansatz: Frauen verarbeiten Sprache mit beiden Hirnhälften, Männer nur einseitig. Bezogen auf das Abstraktionsvermögen oder den Wortschatz sind die Befunde jedoch widersprüchlich.
In einer besonders bekannten Studie mussten je 19 Männer und Frauen diverse Sprachaufgaben lösen. Lediglich bei der Reimunterscheidung fanden die Wissenschaftler im Mittel Unterschiede in der Hirnaktivität der Geschlechter. Und nur 11 der 19 untersuchten Frauen zeigten eine deutliche Aktivität in beiden Hirnhälften. „Dennoch wird diese Untersuchung immer wieder genutzt als der Beleg: Frauen arbeiten in der Sprache beidseitig, Männer einseitig“, kritisiert die Professorin.
Eine andere Forschergruppe ließ 100 Personen Wortpaar-Aufgaben lösen und konnte keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern feststellen. In jüngerer Zeit erschienen einige Meta-Analysen, die Ergebnisse vieler verschiedener Studien zusammenfassten. Diese konnten ebenfalls keine geschlechterübergreifenden Unterschiede ausmachen. Insbesondere in Untersuchungen mit einer geringen Anzahl von Probanden seien die Befunde widersprüchlich, so Schmitz. Insgesamt sei die Heterogenität innerhalb der Geschlechtergruppen häufig größer als zwischen den Gruppen.
Raumorientierung. Räumliches Vorstellungsvermögen gilt gemeinhin als Domäne der Männer, obwohl die wissenschaftlichen Belege dafür dünn sind. Bei einem Versuch mussten je zwölf Probanden mit einer Maus ein Computerlabyrinth durchfahren. Ergebnis: Im Mittel verarbeiteten Frauenhirne Objekte und Landmarken stärker, bei Männern dominierte die geometrische Orientierung. „Die Forscher betonen aber, dass alle Personen in allen Hirnregionen Aktivität zeigen“, präzisiert die Professorin.
Ein anderer Wegfinde-Versuch anhand einer alten Karte von Maastricht habe keine Unterschiede feststellen können. Die mögliche Erklärung: Den Studien liegen verschiedene methodische Auswertungen zugrunde. Es komme darauf an, ab welcher Schwelle Hirnaktivität als relevant angesehen wird, so Schmitz.
„Besonders in der populärwissenschaftlichen Verbreitung wird eher auf Untersuchungen Bezug genommen, die Unterschiede festgestellt haben“, kritisiert die Gender-Forscherin. Aus einer einzelnen Untersuchung mit zum Teil sehr wenigen Probanden werde geschlossen auf „die Frau“ oder „den Mann“. Forschung und Gesellschaft seien immer noch fokussiert auf die Suche nach Differenzen. „Das führt zu unzulässigen Generalisierungen.“
In der Wissenschaft habe sich die Diskussion inzwischen aber verändert. Die so genannte Hirnplastizität geht davon aus, dass Erfahrungen in sozialen Interaktionen das Gehirn verändern:
Erwachsene Versuchspersonen, die früh mehr als eine Sprache erlernt haben, aktivieren in jeder Sprache ihre Hirnregionen gleich, ergab eine Untersuchung. Wer erst spät eine zweite Sprache lernt, nutzt in dieser Sprache sein Gehirn anders als in der ersten.
Wer früh beidhändig Klavier spielt, also die beiden Gehirnhälften sehr stark zusammen trainiert, kann als Erwachsener mit beiden Händen ähnlich genau agieren. Denn das frühe Training bewirkt, dass die Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften in bestimmten Bereichen stärker ausgeprägt ist.
Zu Geschlechtererfahrungen und Veränderungen im Gehirn gebe es zwar keine Untersuchungen, gibt die Professorin zu bedenken. Doch zeigten die Studien: Befunde zur Hirnstruktur seien immer nur eine Momentaufnahme, besonders bei Erwachsenen mit ihren individuellen Biografien. In unserer Gesellschaft würden besonders Kinder und Jugendliche stark nach Geschlecht sozialisiert. Dadurch könnten biologische Strukturen und Funktionen zum Teil „gegendert“ werden.
Auch die Übernahme von gesellschaftlichen Vorstellungen, der so genannte Stereotype Threat, beeinflusse die Leistungen von Männern und Frauen: Wenn eine Aufgabe als Versuch zur räumlichen Orientierung präsentiert werde, lösen Männer sie schneller – wenn auch nicht unbedingt besser. Werde derselbe Versuch eher geschlechtsneutral präsentiert, minimieren sich die Unterschiede.
Sigrid Schmitz: Frauen und Männer und „ihre Natur“ – zur Dekonstruktion biologistischer Stereotype, Vortrag auf der 6. HBS-Gleichstellungstagung, 30. September 2011.