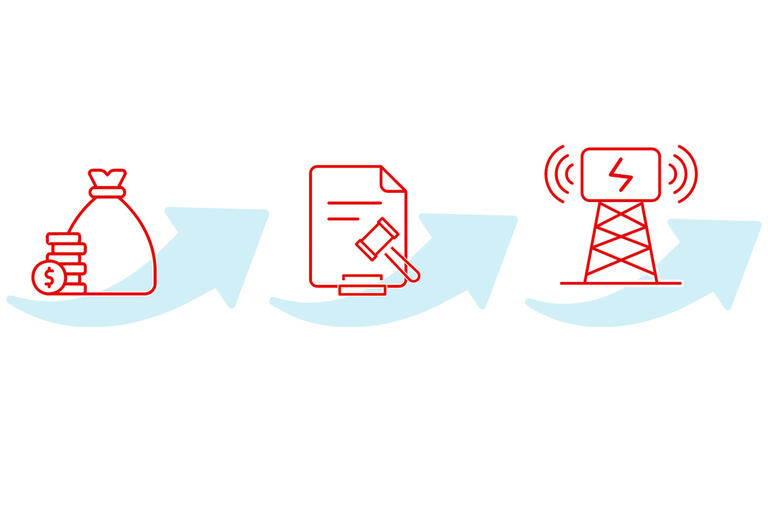: Umkämpfte Geldgeschäfte
FINANZSYSTEM Sparkassen sind keine reinen Gewinnmaximierer, Landesbanken versorgen die regionale Wirtschaft. Privatbanken und einige CDU-Politiker wollen diesen Finanzverbund zerschlagen.
Von MARIO MÜLLER. Der Autor arbeitet als freier Wirtschaftsjournalist in Frankfurt/Main.
Erst verzockt sich die WestLB mit dubiosen Aktiengeschäften, dann treiben Fehlspekulationen in zweitklassigen US-Hypotheken die halbstaatliche IKB und die SachsenLB an den Rand des Ruins. Können Banken unter öffentlicher Obhut nicht vernünftig mit Geld umgehen - etwa weil bei ihnen die Politik mitmischt und die Kontrolle versagt?
Durch die jüngsten Schieflagen gerät die S-Finanzgruppe aus Sparkassen und Landesbanken noch stärker unter Druck. Wirtschaftsliberale Systemkritiker fordern seit Jahren, der Staat möge sich gefälligst aus dem Geldgeschäft zurückziehen. Die öffentlich-rechtlichen Institute stünden einer dringend notwendigen "Strukturreform" des deutschen Kreditgewerbes im Wege, so die weitere Begründung. Nur durch eine Privatisierung ließe sich die heillos zersplitterte, ineffiziente und zu wenig profitable Branche wieder auf ein wettbewerbsfähiges Niveau hieven.
Die Litanei findet zunehmend Gehör. NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) denkt laut über den Verkauf der angeschlagenen WestLB an einen Finanzinvestor nach, Bürgermeister wollen die örtliche Sparkasse versilbern, "Heuschrecken" greifen nach Landesbanken. Die Zeichen stehen auf Privatisierung und damit auf Zerschlagung des öffentlich-rechtlichen Finanzverbunds. Sollte dies gelingen, sind weit reichende negative Folgen für Kunden und Beschäftigte, aber auch die Volkswirtschaft insgesamt zu befürchten.
Hoch riskante Transaktionen_ Umso unverständlicher, dass Landesbanken mit hoch riskanten Transaktionen ihre eigene Existenz aufs Spiel setzen. Warum wettet die WestLB mit Auto-Aktien an der Börse, was hat die SachsenLB in der Finanzierung von US-Immobilien zu suchen? Weil sie auf Gewinne aus waren und anderweitig nicht fündig wurden, lautet die simple Antwort. Wer es komplizierter mag, muss die besondere Situation und Funktion der Landesbanken berücksichtigen. Als gemeinschaftliches "Eigentum" von Bundesländern und Sparkassen sind sie Diener zweier Herren.
Der eine verlangt Unterstützung bei wirtschaftspolitischen Projekten in der Region, der andere möchte möglichst günstig mit Finanzdienstleistungen versorgt werden. Da die Entlohnung von beiden Seiten nicht allzu üppig ist, versuchen die Landesbanken mit Geschäften auf eigene Rechnung ihre Kassen zu füllen, wobei sie, ebenso wie die Großbanken, keinen besonderen Einschränkungen unterliegen, zumindest nicht in der Theorie.
Die Praxis sieht etwas anders aus. Der heimische Markt ist weitgehend verteilt, der Wettbewerb hart. Einerseits sollen die Landesbanken ihren "Muttergesellschaften", den Sparkassen, keine Konkurrenz machen, andererseits gelingt es ihnen nur schwer, den privaten Geldhäusern interessante Kunden abzujagen. Da sie zudem meist nicht auf günstige Spareinlagen zugreifen können, suchten sie, um ihre Gewinnmargen aufzupäppeln, immer wieder ihr Heil im Ausland und nahmen hohe Risiken in Kauf. So setzte die WestLB mit einem Kredit für den englischen Fernsehgeräte-Verleiher Box-Clever Hunderte von Millionen in den Sand.
Nach ähnlichem Muster verfuhr auch die SachsenLB. Die über eine Tochtergesellschaft in der Steueroase Dublin betriebene Finanzierung von zweitrangigen US-Hypotheken bescherte der Mutter in Leipzig jahrelang satte Erträge. Ex-Vorstandschef Herbert Süß sprach von einer "Wundertüte". Nachdem die geplatzt war, räumte Ministerpräsident Georg Milbradt (CDU) freimütig ein, dass "durch Geschäfte außerhalb Sachsens die Verluste im Freistaat subventioniert" wurden, die dem Institut etwa mit Immobilien oder Firmenkunden entstanden waren.
Komplexität schafft Kontrollprobleme_ Die Debakel lassen auf ein massives Versagen der Kontrollinstanzen schließen. Offenbar haben sich die Aufsichtsräte von den zweifelhaften Erfolgen blenden lassen und nicht so genau hingeschaut. Daraus auf mangelnde Qualifikation der in den Spitzengremien von Landesbanken sitzenden Vertreter aus Politik, Sparkassen oder gegebenenfalls Belegschaften zu schließen, griffe allerdings zu kurz. Auch erfahrene Manager wie Ulrich Hartmann, Ex-Chef des Energieriesen E.on, bieten als Aufsichtsräte keine Gewähr gegen Schieflagen - wie der Fall IKB zeigt.
Das Problem liegt tiefer. Globale Finanzgeschäfte haben inzwischen eine Komplexität erreicht, die selbst Experten kaum noch durchschauen. "Neue Produkte und Tätigkeitsfelder machen es den Aufsichtsgremien immer schwerer, ihre Kontrollfunktionen auszuüben", weiß Jörg Reinbrecht, Sprecher für den Fachbereich Finanzdienstleistungen bei ver.di und Mitglied mehrerer Bank-Aufsichtsräte.
Wenn dann noch Risiken, wie bei der SachsenLB oder der IKB, außerhalb der Bilanz versteckt werden oder Rating-Agenturen die Engagements als gefahrlos qualifizieren, muss man sich über mangelhafte Kontrollen nicht wundern. Der ehemalige Chef eines großen Instituts der S-Finanzgruppe warnt denn auch davor, die Rolle der Aufsichtsräte überzubewerten: "Es kommt immer auf den Vorstand an."
Welche Konsequenzen sind also aus den Schieflagen zu ziehen? ver.di-Mann Reinbrecht mahnt die Vertreter der Arbeitnehmer, in Aufsichtsräten "ihre Kontrollrechte konsequent und hartnäckig wahrzunehmen" und dabei Konflikte nicht zu scheuen. Zudem spricht er sich dafür aus, die Geschäfte der Landesbanken zu beschränken: "Öffentliche Kreditinstitute müssen nicht all das machen, was private Geldhäuser tun, das gehört nicht zu ihren Aufgaben." Doch auch ein solcher Schritt ist nicht ohne Tücken.
Abgesehen von der Schwierigkeit, in einer eng verwobenen Finanzwelt "gute" und "schlechte" Geschäften zu unterscheiden, provozieren Verbote geradezu trickreiche Umgehungsversuche. Sinnvoller erscheint, die Banken generell zu bremsen, indem man sie dazu zwingt, mehr Eigenkapital als Risikopolster vorzuhalten. Im Fall Sachsen kommen derartige Vorschläge zu spät. Der Freistaat musste die finanziell ausgezehrte Landesbank an deren baden-württembergische "Schwester" LBBW verkaufen.
Zuvor hatte bereits die Landesbank Berlin, die mit Immobiliengeschäften gewaltige Verluste gebaut hatte, den Besitzer gewechselt. Sie ging für 4,6 Milliarden Euro an die Sparkassen, die unbedingt verhindern wollten, dass bei dem Institut eine private Bank oder gar eine "Heuschrecke" einsteigt.
Auch bei der WestLB sähe es die S-Finanzgruppe am liebsten, wenn sich das angeschlagene Düsseldorfer Geldhaus mit der öffentlich-rechtlichen LBBW zusammenschlösse. Doch die privatisierungsgierige Koalition aus CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen verfolgt andere Pläne. Regierungschef Rüttgers ließ jedenfalls nach weiteren Interessenten suchen.
Zu ihnen soll auch der Finanzinvestor Flowers zählen. Er hält bereits Anteile an der HSH Nordbank, die aus der Fusion der Landesbanken von Hamburg und Schleswig-Holstein hervorgegangen ist. Ein Zusammenschluss der WestLB mit der LBBW kann nicht im Sinn der Landesregierung sein, denn für den Standort Düsseldorf wären erhebliche Verluste sowohl an Bedeutung als auch an Arbeitsplätzen zu befürchten. Dann aber dürfte die WestLB auch nicht an den Finanzinvestor Flowers verkauft werden.
Konsolidierung meint Zerschlagung_ Bei marktwirtschaftlichen Puristen würde dieses Szenario allerdings Jubel auslösen. Ihnen sind Landesbanken und Sparkassen schon lange ein Gräuel. Schließlich stellen sie mit einem Anteil von 36 Prozent am Geschäftsvolumen aller Geldhäuser die stärkste Kraft im hiesigen Kreditgewerbe dar. Weitere zwölf Prozent entfallen auf die als Genossenschaften firmierenden Volks- und Raiffeisenbanken (siehe Grafik). Legt man Kredite an Unternehmen sowie Selbstständige oder Spareinlagen zugrunde, erhalten beide Gruppen ein noch höheres Gewicht.
Mindestens die Hälfte des traditionellen Geschäfts läuft also durch die Bücher von Instituten, die es mit den Regeln des Kapitalismus nicht so genau nehmen. Denn weder Sparkassen noch Genossenschaftsbanken verstehen sich als reine Gewinnmaximierer. Erstere sind laut Gesetz gehalten, dem Gemeinwohl zu dienen, indem sie die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Finanzdienstleistungen in ihrer Region sicherstellen, Letztere vornehmlich den Interessen ihrer Mitglieder verpflichtet.
Klar, dass dies den Anhängern der reinen Lehre missfällt. Seit Jahren schon macht die Lobby der privaten Banken Stimmung gegen die Konkurrenz. Mit Erfolg: Vor gut zwei Jahren erklärte die EU-Kommission auf Drängen der privaten Banken staatliche Garantien für Sparkassen und Landesbanken für unzulässig, weil sie als Beihilfen den Wettbewerb verzerrten, und versetzte damit den öffentlichen Geldhäusern einen herben Schlag.
Auch der Internationale Währungsfonds (IWF), die Europäische Zentralbank (EZB) oder die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sprechen sich immer wieder mehr oder weniger deutlich für einen Rückzug des Staats aus dem Kreditgewerbe aus. Nur durch die Privatisierung von Sparkassen und Landesbanken lasse sich die kleinteilige Branche auf mehr Effizienz trimmen und die dringend gebotene "Konsolidierung" erreichen, lautet unisono die Botschaft.
Bahn frei für die Finanzgiganten_ Die Zielrichtung der "Modernisierer" bringen die Wirtschaftsprofessoren Franklin Allen und Reinhard H. Schmidt, die der Privatisierung skeptisch gegenüberstehen, auf den Punkt: "Auch in Deutschland soll der Kapitalmarkt die Hauptrolle spielen, neben ihm soll es künftig nur noch private Banken geben" (Interview Seite 51). Und möglichst wenige. Denn die geforderte Konsolidierung bedeutet nichts anderes als knallharte Konzentration. Modell stehen Staaten wie Großbritannien oder die Niederlande, wo ein kleiner exklusiver, Kreis von Finanzgiganten den Markt beherrscht.
Dabei ist die "Konsolidierung" unter den Landesbanken in vollem Gang. Aus einstmals zwölf wurden inzwischen sieben, und ihre Zahl dürfte weiter schrumpfen. Eine Privatisierung würde allerdings das gesamte Gefüge ins Wackeln bringen. Denn die Landesbanken übernehmen nach wie vor wichtige Aufgaben für die Sparkassen. Ohne den Überbau könnte aber auch die Basis in der jetzigen Form nicht mehr existieren.
Die Sparkassen sind "ein bedeutsamer Standortvorteil" für die Bundesrepublik, meint Christian Ude, Münchner OB und Präsident des Deutschen Städtetags. Dies gilt vor allem für wirtschaftlich hinterherhinkende Regionen. Sparkassen könnten "aufgrund ihres spezifischen Geschäftsmodells der räumlichen Nähe und der intensiven Kundenbeziehungen" vor Ort "gleichzeitig Wachstumspotenziale unterstützen und zum Ausgleich" von Unterschieden in der ökonomischen Entwicklung beitragen, heißt es in einer aktuellen Untersuchung des Instituts Arbeit und Technik.
Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte auf dem Deutschen Sparkassentag in Bochum die Bedeutung der öffentlichen Institute und erteilte der Privatisierung eine Absage. "Wo Sparkasse draufsteht, ist auch Sparkasse drin", erklärte die Bundeskanzlerin zur Freude des Publikums. "Und das soll auch so bleiben."
Wenn sich Frau Merkel da mal nicht täuscht. Denn in ihrer Partei wird heftig an den Grundfesten der S-Finanzgruppe gerüttelt. Rüttgers und sein hessischer Kollege Roland Koch haben Gesetze auf den Weg gebracht, nach denen Sparkassen so genanntes Stammkapital bilden sollen. Dadurch werden Anteile an Sparkassen zu Handelsobjekten, wenn auch zunächst nur innerhalb der öffentlich-rechtlichen Gruppe.
Entscheidender ist, dass die Begehrlichkeiten jener städtischen Kämmerer geweckt werden, die sich nun als Eigentümer ihrer Sparkasse fühlen und von den Einnahmen aus einem Verkauf träumen dürfen. In Stralsund ist ein entsprechender Vorstoß zwar gescheitert. Doch der Kampf geht weiter. "Natürlich muss eine Stadt keine Sparkasse betreiben", sagt der Oberbürgermeister von Düsseldorf, Joachim Erwin (CDU). Sparkassen-Präsident Heinrich Hassis hofft trotz allem, den Laden zusammenhalten zu können.
Die Länder als Gesetzgeber und Miteigentümer von Landesbanken sollten erkennen, "dass sie heute gemeinsam mit den Sparkassen noch einen Schlüssel zur Stärkung des deutschen Bankensystems in der Hand haben", appelliert er an Rüttgers, Koch und Kollegen. Unterstützung findet der Spitzenfunktionär unter anderem bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di: Nur ein breites politisches Bündnis könne weitere Auflösungserscheinungen verhindern, meint Werner Aßmann, der Vorsitzende der Bundesfachgruppe Sparkassen bei ver.di.
Drei Millionen Briten haben kein Girokonto_ Es steht eine Menge auf dem Spiel, nicht nur für die rund 377000 Beschäftigten der S-Finanzgruppe, die bei einer größeren Privatisierungswelle um ihre Arbeitsplätze bangen müssten. Auch die Struktur- und Industriepolitik wäre betroffen, "Porsche wäre nicht nach Leipzig gekommen, wenn die SachsenLB nicht vorher Grundstücke angekauft hätte", sagt Ministerpräsident Milbradt. Zudem hätte eine ganze Reihe von Betrieben "nur überleben können, weil die Landesbank ihnen geholfen hatten."
Den Schaden hätten schließlich die Kunden. Was auf sie zukommt, wenn das Geldgeschäft voll in privater Hand ist, zeigt das Beispiel England. Dort haben drei Millionen Haushalte keinen Zugang zu einem Girokonto. Die britische Kartellbehörde spricht von einem "komplexen Oligopol", das die Kunden kräftig abzockt.