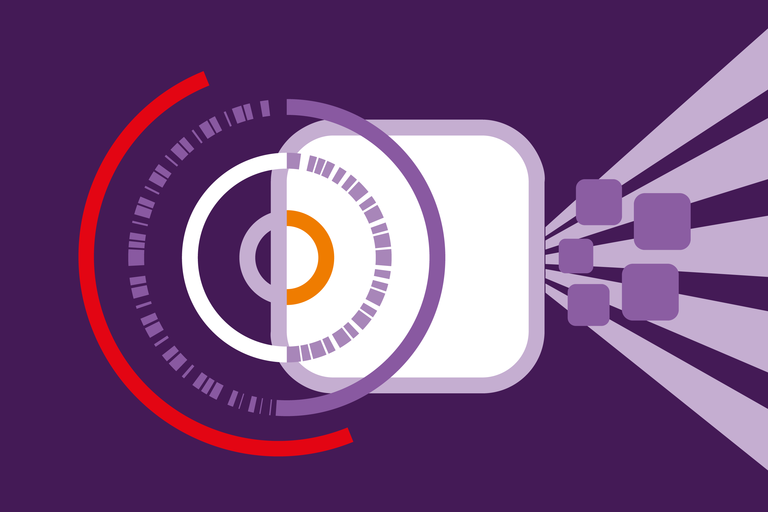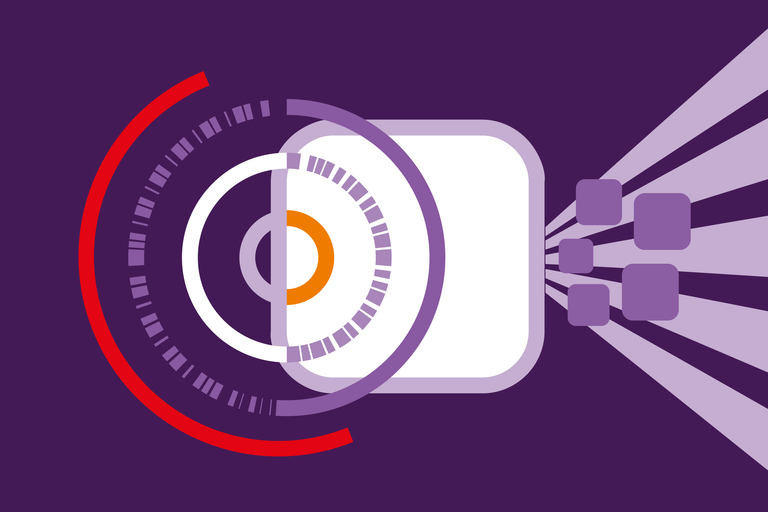: INTERVIEW 'Gekränkte Arbeitsgesellschaft'
Der Industriesoziologe Michael Behr über Deklassierungserfahrungen ostdeutscher Facharbeiter und Probleme der ostdeutschen Industrie.
Die Fragen stellte CORNELIA IRNDT, Redakteurin des Magazins Mitbestimmung/Foto: transit
Sie prognostizieren, dass Ostdeutschland eine zweite Wende bevorsteht, die über die Zukunft der industriellen Basis in Ostdeutschland entscheiden wird. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Die Qualitätsproduktion der zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen verdanken wir innovativen Ingenieuren und Facharbeitern. Die pflegen in ihren Betrieben einen ausgeprägten Zusammenhalt und kooperieren ausgesprochen unkompliziert auch über Statusgrenzen hinweg. Dieses Human- und Sozialkapital ist - neben den überaus modernen Produktionsanlagen - der entscheidende Erfolgsfaktor in den neuen Ländern. Viele dieser Kompetenzträger werden demnächst von Bord gehen, ohne dass ausreichend viele junge Fachkräfte aufgebaut werden konnten. Diesen demografisch bedingten Umbruch im ostdeutschen Beschäftigungssystem bezeichne ich als zweite Wende.
Welche Risiken birgt die Überalterung der Erwerbsbevölkerung?
Gelingt es den Industrieunternehmen nicht, das erforderliche Humanvermögen aufzubauen, zu integrieren und produktiv zu nutzen, ist die gegenwärtige Position in den Wertschöpfungsketten, die sich viele Unternehmen hart erkämpft haben, nicht zu sichern. Verliert Ostdeutschland an Innovationskraft, kann es in der Sandwichposition zwischen Preiskonkurrenten im Osten und etablierten Marktteilnehmern im Westen nur verlieren.
"Eine der größten Schwächen der ostdeutschen Gesellschaft ist es, den Schatz der geburtenstarken Jahrgänge nicht gehoben zu haben", schreiben Sie. Was ist da schiefgelaufen?
Die Geburtenraten gingen in den späten 70er und 80er Jahren unter sozialistischen Vorzeichen hoch, ehe sie in der Nachwendezeit geradezu abstürzten - und zwar dauerhaft. Es gehört zur traurigen Ironie der deutschen Wiedervereinigung, dass zu der Zeit, als die geburtenstarken Jahrgänge ins Bildungs- und Beschäftigungssystem strömten, dort in den neuen Ländern nicht mehr viel zu holen war. Nach 1995 verringerten sich die Beschäftigungsperspektiven zunehmend - auch weil in kürzester Zeit 1,4 Millionen Arbeitnehmer frühverrentet worden waren. Damit erlebten die neuen Länder ein problematisches Nachwendeparadox: Besonders viele junge Leute drängten ins Beschäftigungssystem, aber bekamen keinen Job, sodass der Anteil der unter 30-Jährigen im Beschäftigungssystem in dieser Zeit massiv zurückging.
Der Umbruch wurde weitgehend sozialpolitisch abgesichert. Konnte das angesichts der massiven Arbeitsplatzverluste gar nicht so richtig gewürdigt werden?
In gewisser Weise ist Ostdeutschland eine gekränkte Arbeitsgesellschaft. In nur drei Jahren waren nach der Wende 40 Prozent der Arbeitsplätze weggebrochen - nur durch Vorruhestand, Kurzarbeit null und massenhafte Nutzung von ABM konnte Desintegration und Verarmung verhindert werden. Zu den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gehört auch die Rücksendung von Ausländern - mit dem fatalen Ergebnis, dass wir heute eine vollständige ethnische Homogenisierung der ostdeutschen Gesellschaft haben. Und dennoch ging das Kalkül nicht auf, diese transformationsbedingte Anpassungssituation bald zu überwinden. Der Neuaufbau von Arbeitsplätzen blieb weit unter den Erwartungen und die subjektive Beschäftigungs-Unsicherheit besonders ausgeprägt. Das verstellt nicht selten den Blick auf Erfolge, so ist die Erwerbsbeteiligung in einigen Regionen sogar höher als in Westdeutschland.
Wurde das Ziel gleicher Lebensverhältnisse erreicht?
Es gibt wenige Gegenden auf der Welt, in denen die Lebensverhältnisse in so kurzer Zeit so stark angehoben wurden wie in den neuen Bundesländern. Nirgendwo haben sich die Konsummöglichkeiten, die Ausstattung der Haushalte mit modernen Küchen, Automobilen oder Unterhaltungselektronik so rasch verbessert. Der Bund hat hier gründliche Arbeit geleistet. Pensionen, BAföG, die Einkommen im öffentlichen Sektor - alles, was staatlich festgelegt wird, wurde vollständig oder doch weitgehend angeglichen. Und die gesetzlichen Durchschnittsrenten sind im Osten bekanntlich höher als im Westen.
Was halten Sie von der Lebensqualität auf dem Gebiet der ehemaligen DDR?
Die Kinderbetreuung ist deutlich besser als im Westen, und man kann hier viel eher ein Eigenheim erwerben. Wenn man die Lebensqualität im dünner besiedelten, landschaftlich reizvollen Osten Deutschlands betrachtet, mit einem guten Freizeitangebot, einer sozialen Infrastruktur mit schön sanierten Städten und preiswerten Wohnungen, dann weisen nicht wenige Regionen in Thüringen oder Sachsen, aber auch Sachsen-Anhalt, Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern inzwischen eine höhere Attraktivität aus als viele Regionen in Westdeutschland.
Ein Ziel ist vor allem nicht erreicht worden - dass die Transferökonomie mal ein Ende findet. Aber ist Transfer von Bundesland zu Bundesland nicht die Regel?
In der Tat liegen die neuen Länder beim BIP bei 80 Prozent, das ist so schlecht nicht. Aber die Transferabhängigkeit ist in allen Bereichen inklusive der Sozialsysteme, Renten, Arbeitslosenversicherung und Krankenversicherung erheblich. Vielleicht ist es nicht ganz gerecht, nur die Transferbewegung von West nach Ost zu betrachten, denn schwache Westländer profitieren ja auch von Finanzströmen etwa aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Aber auf Dauer droht ein Legitimationsverlust dieser Transfersolidarität, wenn nicht absehbar ist, dass wenigstens Thüringen und Sachsen einmal vom Nehmer- zum Geberland werden. Das muss die Perspektive sein. Aber dies setzt eine Wirtschaftsstruktur mit wettbewerbsfähigen Unternehmen in den neuen Ländern voraus.
Und gute Einkommen: Rentner und Staatsangestellte können Ihrer Ansicht nach nicht klagen. Wie sieht es für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft aus?
Das ist der Punkt. Ein Paradox der transfergeprägten Einigungspolitik liegt darin, dass im Osten die Einkommen immer kleiner werden, je mehr man sich dem eigentlichen Wertschöpfungskern der Wirtschaft nähert. Nicht ganz zu Unrecht nehmen sich viele Facharbeiter als Verlierer der Einheit wahr. Ihr Einkommen, aber auch das der Ingenieure, liegt rund 30 Prozent unter den Einkommen ihrer westdeutschen Kollegen. Hinzu kommt, dass die Vermögenswerte der Ostdeutschen deutlich hinter dem Westen hinterherhinken. Das aber drückt das BIP, die Finanzierung der Sozialsysteme und der öffentlichen Haushalte, die sich ja nun einmal aus dem Preisniveau für Waren und Arbeitsleistungen ergeben.
Müssten die Löhne steigen?
Schauen Sie sich einmal die traurigen Preise an, die Sie in der Gastronomie Brandenburgs oder Thüringens durchsetzen können, und vergleichen Sie die mit den Gaststätten in Baden-Württemberg. Da können Sie erahnen, mit welchen Löhnen Köche und Bedienungspersonal in den neuen Ländern abgespeist werden. Und dies ist nun mal ein Teufelskreis. Wer mit Niedrigstlöhnen auskommen muss, kann selbst nur billig einkaufen. So gesehen ist eine offensive Politik, progressive Löhne und Gehälter durchzusetzen und nach unten hin wenigstens durch Mindestlöhne die schlimmsten Verwerfungen zu verhindern, auch ein Beitrag zur Regionalentwicklung. Ein vernünftiges Lohnniveau ist ein starkes Bleibemotiv. Und Wirtschaft braucht gute Leute, wenn sie die Gewinne erwirtschaften will, die erforderlich sind, um qualifizierte Arbeitnehmer angemessen zu entlohnen.
Die ostdeutschen Facharbeiter leiden auch unter einem Verlust der Wertschätzung, wie Sie in einer von der Otto Brenner Stiftung geförderten Befragung von mehr als 1100 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie herausgefunden haben. Warum?
Facharbeiter bewerten ihre Arbeitsbedingungen deutlich schlechter als die Ingenieure, sie nehmen sich nicht nur als betriebliche, sondern auch als gesellschaftliche Verlierer wahr. Die ostdeutschen Facharbeiter fühlen sich betriebspolitisch an den Rand gedrängt und haben den Eindruck, für harte Arbeit nicht annähernd angemessen wertgeschätzt zu werden. Besonders kritisiert werden die fehlenden Weiterbildungs- und Partizipationsmöglichkeiten.
Sie haben festgestellt, dass die betrieblichen Sozialbeziehungen abgekühlt sind. Ihrer Ansicht nach läuft das auf ein Standortrisiko hinaus. Warum?
Wo die Angst regiert, werden Verbesserungsideen zurückgehalten. Fehlende Anerkennung führt zum emotionalen Rückzug der Beschäftigten. Ich sehe auch ein Problem darin, dass die Facharbeit in den Familien keinen guten Ruf hat. Während eine Mehrheit der Ingenieure ihren Kindern den eigenen Beruf empfehlen würde, tut dies nur eine Minderheit der Facharbeiter. Die ostdeutsche Industrie braucht aber kluge junge Leute mit Verständnis für komplexe technische Vorgänge und handwerklichem Geschick. Orientiert sich der potenzielle Nachwuchs anders, hat das verarbeitende Gewerbe ein Problem.
Drei Viertel der Beschäftigten in der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie werden durch Betriebsräte vertreten. Da müsste es doch ausreichend Mitbestimmungsmöglichkeiten geben?
Betriebsräte bekommen von den Belegschaften in der Regel sehr gute Noten für ihr Engagement und ihre inhaltliche Arbeit, nicht so gute jedoch für ihre Durchsetzungsfähigkeit. Ostdeutsche Betriebsräte sind überwiegend sehr konzessionsbereit und wenig konfliktorientiert, was, das muss man sagen, auch der Mentalität der meisten Beschäftigten entspricht. Nicht wenige Betriebsräte verzichten auf die Freistellung, die ihnen zusteht, um nicht den Eindruck zu erwecken, sich Privilegien zuzubilligen. Das alles bremst die Möglichkeiten eines konsequenten, professionellen Mitbestimmungsregimes im Sinne echter Gegenmacht doch etwas aus.
Was könnten Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände und Politik tun, um die Modernisierungsblockade in ostdeutschen Unternehmen aufzubrechen?
Wenn ich Vorträge vor Unternehmensvertretern halte, weise ich auf diese Gefahr hin. Nicht wenige haben ein echtes Aha-Erlebnis, weil sie sich die Veränderungen in der sozialen Tiefenstruktur ihres Unternehmens nicht bewusst gemacht haben. Ich glaube, dass es Chancen für einen neuen Pakt in den Unternehmen gibt. Die ostdeutschen Industrieunternehmen sind selbstbewusst, sie müssen nicht mehr ums nackte Überleben kämpfen, sie sind gut in die gesamtdeutschen Wertschöpfungsketten integriert. Jetzt ist die Zeit, die betrieblichen Sozialbeziehungen zum Thema zu machen.
Gibt es Vorreiter?
Es gibt vorzeigbare Firmen, in denen Geschäftsführer, Betriebsräte und Belegschaften gleichberechtigte Akteure betrieblicher Innovationsprozesse sind. Der Facharbeitermangel könnte die Position der Beschäftigten verbessern und einer neuen Kultur der Arbeit in Ostdeutschland Rückenwind verschaffen. Das ist meine Hoffnung - trotz Krise.
ZUR PERSON
Michael Behr, 49, arbeitet am Lehrstuhl für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Arbeitsmarkt, Ostdeutschland, industrielle Beziehungen sowie Managementsoziologie. Der bekennende "Wossi", der in Freiburg, Bielefeld und Erlangen studierte, lebt und arbeitet seit 15 Jahren in Jena.
Mehr Informationen
Michael Behr: Ostdeutschland - ein prognostisches Dauerproblem. Von der Planungseuphorie der Transformationsphase zu den offenen Planungshorizonten in der "zweiten Wende". Erscheint in: Mittelweg 36. Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung, Heft 6/2009 (Dezember)
Ders.: Der unglückliche Erfolgsfaktor - beschleunigt, aktiviert, aber nicht zukunftsfähig. In: WSI-Mitteilungen, Ausgabe 10/09. Schwerpunktheft "Beschleunigt - Aktiviert - Zukunftsfähig? Leben und Arbeiten im Kapitalismus"
Ders.: Blockierte Modernisierung ostdeutscher Unternehmenskulturen als Standortrisiko. Wie die Erosion des Nachwendepaktes die weitere Konsolidierung der Industrie gefährdet. In: Rainer Benthin und Ulrich Brinkmann (Hrsg.): Unternehmenskultur und Mitbestimmung. Betriebliche Integration zwischen Konsens und Konflikt. Frankfurt/New York, Campus 2008