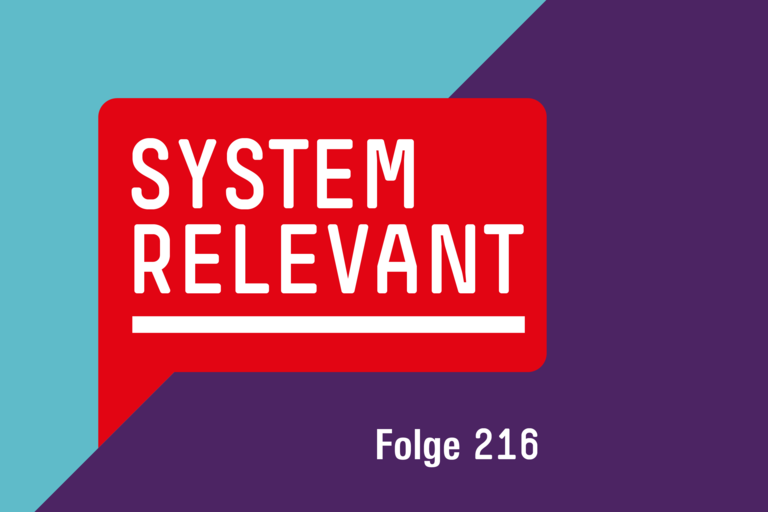Armut: „Die Angst vor dem Abstieg wächst“
Dorothee Spannagel vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung über einen löchrigen Sozialstaat, dem immer weniger Menschen vertrauen. Das Gespräch führten Clara Libovsky und Fabienne Melzer
Nach Ihrer Studie fühlt sich eine Mehrheit vom Sozialstaat nicht mehr ausreichend geschützt. Ist das ein rein subjektives Gefühl?
DOROTHEE SPANNAGEL: Eine Mehrheit sagt: Was der Sozialstaat mir an Absicherung bietet, reicht nicht. Das ist das, was die Menschen empfinden, wie gut oder schlecht sie sich aufgefangen fühlen.
Können Sie dieses subjektive Gefühl objektiv bestätigen?
Das können wir. Wir haben uns die Entwicklung der Markteinkommen – also der Einkommen vor Steuern und Transferleistungen – zwischen 2010 und 2021 angeschaut. Da ändert sich die Verteilung wenig. Bei den Markteinkommen gehen die Armutsquoten sogar leicht zurück. Wenn man sich aber die verfügbaren Einkommen anschaut – nach Abzug von Steuern und Erhalt von Transferleistungen – steigt im gleichen Zeitraum die Einkommensungleichheit und die Einkommensarmut. Das nehmen die Menschen auch wahr.
Wie erklären Sie das?
Die Armutsgrenze berechnet sich am mittleren Einkommen. Wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, liegt unter der Armutsgrenze. Zwischen 2010 und 2019 lief es wirtschaftlich sehr gut, manche haben sogar von einem zweiten Wirtschaftswunder gesprochen. Die Arbeitslosigkeit ging stark zurück, Erwerbstätigkeit und Löhne stiegen. Damit ist auch die Armutsgrenze gestiegen. Aber die Leistungen aus dem Arbeitslosengeld II, dem sogenannten ALG II, sind nicht in gleichem Maße gestiegen. Das Gleiche sehen wir bei der Rente, die zunehmend weniger vor Armut schützt.
... weil das Rentenniveau schrittweise gesenkt wurde?
Zum Teil. Hinzu kommt, dass in diesem Zeitraum mehr Menschen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien verrentet wurden, vor allem Frauen, die in Teilzeit oder sehr geringfügig beschäftigt waren. Aber entscheidender ist der Anstieg der Einkommen, von dem untere Einkommensgruppen systematisch weniger profitiert haben.
Es gibt Kritik an diesem Modell, dass man nicht von steigender Armut reden könne, wenn die Einkommen steigen. Was entgegnen Sie?
Ich höre diese Kritik immer wieder, aber ich verteidige das Konzept vehement. Wenn sich viele Menschen mehr leisten können, häufiger essen oder regelmäßig ins Kino, ins Theater gehen können, dann muss das für alle gelten. Dann müssen sich auch Menschen mit geringen Einkommen mehr leisten können als früher, sonst werden sie gesellschaftlich ausgegrenzt. Armut misst sich relativ im Vergleich zum Wohlstand der Gesellschaft. Das ist die Stärke dieses Konzepts.
Auch Menschen mit mittleren Einkommen haben inzwischen Angst vorm sozialen Abstieg. Sind diese Ängste berechtigt?
Diese Ängste haben vor allem zwischen 2020 und 2023 zugenommen. In der oberen Mitte, zu der Menschen mit einem Einkommen zwischen 100 und 150 Prozent des Medians gehören, hatten 2023 mehr als 50 Prozent Angst um ihren Lebensstandard, 2020 waren es weniger als 32 Prozent. Das ist aber auch kein Wunder. Da waren Corona, der Ukrainekrieg, die Inflation. Insofern sind die Ängste sicher real. Ich denke aber auch, dass da Statusängste dahinterstecken. Bei den Armen stieg die Angst in dieser Zeit nur wenig an.
Wo versagt der Sozialstaat, um ihnen diese Angst zu nehmen?
Zum Beispiel bei den Renten: Viele Menschen haben inzwischen Angst – ob zu Recht oder zu Unrecht ist erst einmal egal –, dass das Einkommen im Alter nicht reicht. Da geht es genau um die Frage: Kann ich meinen Lebensstandard in Zukunft halten?
DOROTHEE SPANNAGEL ist Referatsleiterin für Verteilungsanalyse und Verteilungspolitik am WSI und Mitglied des wissenschaftlichen Gutachtergremiums zum Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung.
Wenn Einkommen auseinanderdriften, entfernen sich auch Lebenswelten voneinander. Wohnviertel driften auseinander. Die einen leben im Problem- und die anderen im Villenviertel.“
Viele Menschen wünschen sich mehr Umverteilung, lehnen aber gleichzeitig höhere Steuern ab. Ein Widerspruch?
Ich glaube, Ulrich Schneider, der frühere Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, hat einmal gesagt: „In Deutschland haben sogar Menschen Angst vor Steuererhöhung, die gar keine Steuern zahlen.“ Ich weiß nicht, ob das Zitat genau so stimmt, aber es trifft es ganz gut. In Deutschland haben alle Angst vor Steuern. Steuererhöhungen treffen angeblich immer jeden, sowohl den sogenannten kleinen Mann als auch obere Schichten, wo sie angeblich sofort zu Kapitalflucht führen. Dieses Narrativ wird von der politisch einschlägigen Lobby stark gepflegt, das hat sich in den Köpfen festgesetzt. Bei Steuererhöhungen denken die armen Leute wirklich, dass es auch sie trifft. Da muss man gegen ankämpfen und sagen, Steuererhöhungen
am oberen Ende der Einkommensskala würden sehr viel bringen. Sie würden bei den Einkommen sehr weit oben ansetzen. Und wenn die Leute wissen, wo sie selbst in der Einkommensverteilung stehen, wissen sie auch, dass es sie nicht betrifft.
Aber was ist mit denen, die es trifft? Flüchten die dann ins Ausland?
Eine höhere Reichensteuer oder ein höherer Spitzensteuersatz treffen ja Privatpersonen. Ob sie alle wegen höherer Steuern ins Ausland ziehen wollen oder können, da würde ich ein Fragezeichen hinter setzen. Eine andere Diskussion dreht sich um die Frage der Vermögensbesteuerung. Hier heißt es oft: Wenn wir diese Steuern erhöhen, flüchten die Unternehmen ins Ausland. Es gibt aber Länder, die eine progressive Vermögenssteuer haben, und die haben immer noch Unternehmen.
Wie würden Sie den Zustand unseres Sozialstaates beschreiben?
Etwas löchrig. Den Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt seit den 2000er Jahren etwa hat der Sozialstaat nicht mitgemacht. Die Flexibilisierung in vielen Branchen und die unterbrochenen Erwerbsbiografien müssten besser abgesichert werden.
Bürgergeld und höherer Mindestlohn haben daran nichts geändert?
Der Mindestlohn hat die Lohnungleichheit am unteren Rand verringert und die starke Anhebung des Bürgergelds in den Jahren 2023 und 2024 hat wahrscheinlich den Anstieg der Armut zuletzt etwas gebremst. Das ist aber noch etwas mit Vorsicht zu betrachten, da wir noch nicht viele belastbare Zahlen zur Entwicklung der Armut seit 2022 haben. Zudem reicht beides längst nicht aus, vor allem angesichts der sehr hohen Inflation der letzten Jahre.
Welche gesellschaftlichen Folgen hat die wachsende Armut?
Wenn Einkommen auseinanderdriften, entfernen sich auch Lebenswelten voneinander. Wohnviertel driften auseinander. Vereinfacht gesagt: Die einen leben im Problem- und die anderen im Villenviertel. Dort begegnen sich die Kinder weder in der Schule noch im Sportverein. Ich glaube, dass es für eine Gesellschaft sehr nachteilig ist, wenn sich Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten im Alltag nicht mehr begegnen. Gleichzeitig erleben wir, wie Parteien die gewachsene Verunsicherung, die Ängste vor dem Abstieg politisch ausnutzen.
Nur ein Leben über der Armutsgrenze ist ein Leben in Würde.“
Wie kann die nächste Regierung die Löcher im Sozialstaat flicken?
Sie müsste auf jeden Fall das Bürgergeld deutlich erhöhen. Es kann nicht sein, dass man mit Bürgergeld immer noch unterhalb der Armutsgrenze lebt. Nur ein Leben über der Armutsgrenze ist ein Leben in Würde. Und das Recht auf Würde ist grundgesetzlich verankert. Vor allem muss das Bürgergeld auch bei den Menschen ankommen. Viele machen ihren Anspruch meist aus Scham gar nicht geltend. Das wird durch dieses ganze Gerede von der sozialen Hängematte nur noch schlimmer. Bei den Renten brauchen wir eine Haltlinie, die auch funktioniert. Wir müssen Menschen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien besser absichern, und Pflege darf kein Armutsrisiko werden.
Ein paar Punkte stehen ja schon im Raum, die in den nächsten Koalitionsvertrag kommen könnten. Gibt es da Aussicht auf Besserung?
Wenn der Mindestlohn tatsächlich auf 15 Euro steigt, wäre das gut. Denn die Einführung des Mindestlohns hat den unteren Lohngruppen massiv geholfen.
Gehören zu einem funktionierenden Sozialstaat nicht auch ein gerechtes Bildungssystem?
Wenn man international vom Welfare State spricht, meint man immer auch das Bildungssystem. In Deutschland gehört Bildung seltsamerweise zum Sozialstaat im engeren Sinne nicht dazu. Dabei wissen wir schon seit der ersten Pisa-Studie, wie sehr Bildungschancen bei uns von der sozialen Herkunft abhängen. Bildungsgerechtigkeit ist sicher auch eine sozialstaatliche Aufgabe, aber da ändert sich einfach nichts. Ich würde aber auch die gesamte soziale Infrastruktur dazuzählen. Wenn die Musikschule schließt oder die Stadtbücherei selten geöffnet hat, trifft das ärmere Menschen immer härter. Wenn das Freibad schließt, gucken die in die Röhre, die keinen Pool im Garten haben.
Und wie sieht es mit bezahlbarem Wohnen aus?
Armut bemisst sich ja rein nach dem monatlichen Einkommen, unabhängig von der Miete. Aber es macht natürlich einen Riesenunterschied, ob man davon zwei Drittel für Miete ausgeben muss und sich nur noch trocken Brot leisten kann oder ob man nur ein Fünftel in die Miete steckt. Aber im Grunde berücksichtigt das Armutskonzept das nicht. Was tatsächlich problematisch ist.
DOROTHEE SPANNAGEL ist Referatsleiterin für Verteilungsanalyse und Verteilungspolitik am WSI und Mitglied des wissenschaftlichen Gutachtergremiums zum Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung.