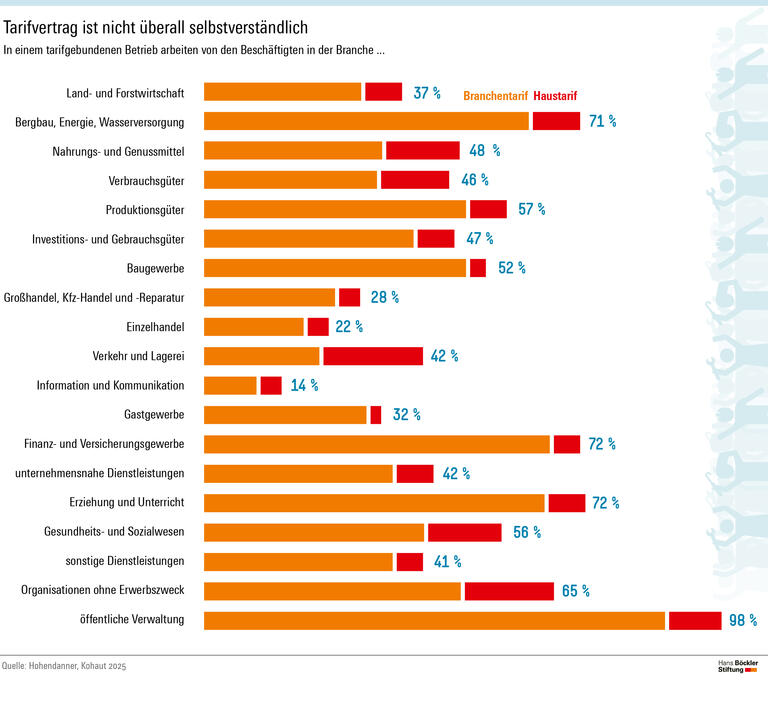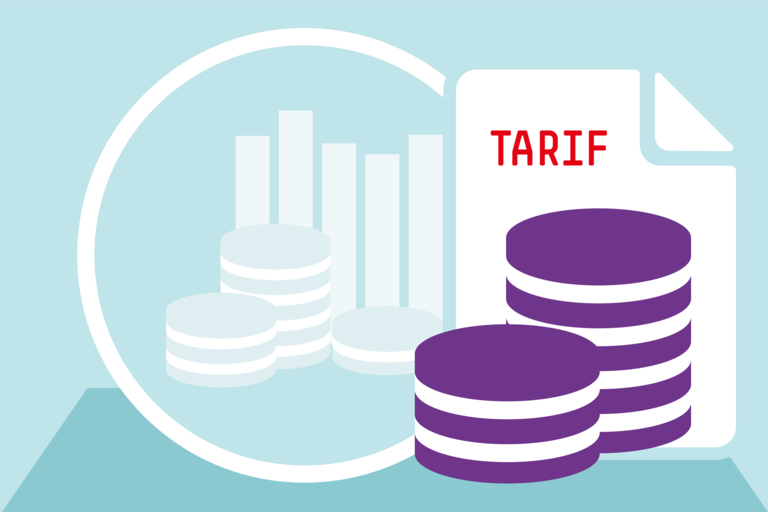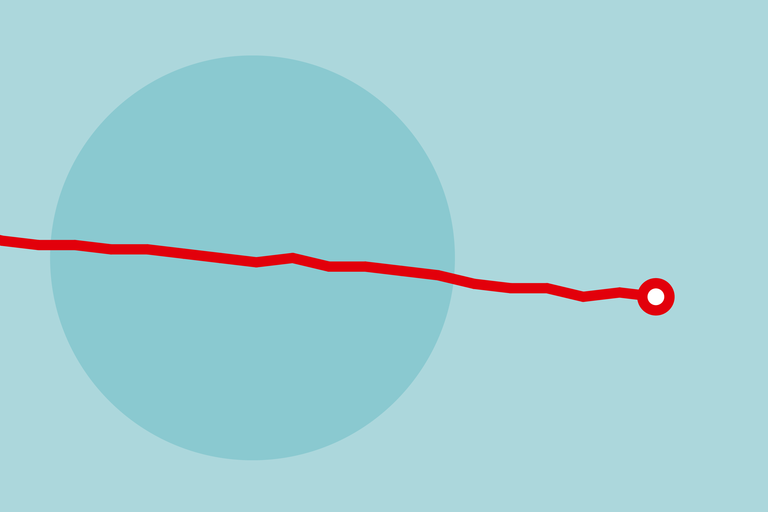Tarifvertrag: Kein Vertrag wie jeder andere
Tarifverträge sind mehr als privatwirtschaftliche Übereinkünfte zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften, denn sie reduzieren ein fundamentales Machtgefälle. Diese hundert Jahre alte Erkenntnis droht in Vergessenheit zu geraten.
Der Jurist Hugo Sinzheimer entwickelte schon in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die Grundidee des zunächst in der Tarifvertragsordnung von 1918 und später im Grundgesetz verankerten Tarifvertragsrechts. In letzter Zeit argumentieren Arbeitgeber aber immer häufiger wie vor dem Ersten Weltkrieg – als sei ein Tarifvertrag ein Vertrag wie jeder andere. Die gesellschaftliche Funktion von Tarifverträgen wird dabei ausgeblendet und Unternehmen, die sich der Tarifbindung entziehen wollen, Tür und Tor geöffnet.
Um die Besonderheiten des Tarifvertragsrechts zu verstehen, lohnt ein Blick zurück, wie WSI-Forscher Thorsten Schulten in einem Aufsatz anlässlich des 150. Geburts- und 80. Todestags von Sinzheimer in diesem Jahr erklärt. Tarifverträge sind, in Sinzheimers Worten, „Mischgebilde“, die teils privatrechtlichen und teils öffentlich-rechtlichen Charakter haben. Diese Rechtsfigur zu entwickeln, hat viele Jahrzehnte gedauert.
Newsletter abonnieren
Alle 14 Tage Böckler Impuls mit Analysen rund um die Themen Arbeit, Wirtschaft und Soziales im Postfach: HIER anmelden!
„Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbstständigen Gewerbetreibenden und den gewerblichen Arbeitern ist“, so hieß es in der Gewerbeordnung des Deutschen Reichs von 1883, „Gegenstand freier Übereinkunft“. Dahinter steht die schlichte wie realitätsferne Vorstellung des Bürgerlichen Rechts, dass der Gerechtigkeit Genüge getan sei, wenn jeder Arbeiter mit jedem Arbeitgeber ungehindert einen beliebigen Lohn aushandeln könne. Die ungleiche Verhandlungsmacht der beiden Vertragsparteien bleibt unberücksichtigt. Dabei hatte 1776 schon der Ökonom Adam Smith darauf hingewiesen, dass die Arbeitgeber stets am längeren Hebel sitzen, weil sie Lohnkonflikte in der Regel länger durchstehen können als Lohnabhängige – eine Erkenntnis, die den Ausgangspunkt für die Klassentheorie von Karl Marx und Friedrich Engels bildet.
Tarifverträge müssen verbindlich sein
Um ihre Verhandlungsposition zu verbessern und Unterbietungskonkurrenz möglichst zu verhindern, schlossen sich die Lohnabhängigen zu Gewerkschaften zusammen. Zunächst in England, bald auch in Deutschland. Es dauerte hierzulande allerdings noch bis zur Jahrhundertwende, bis kollektiv geschlossene Lohnvereinbarungen – Tarifverträge – eine gewisse Verbreitung fanden. Nun begann auch die Rechtswissenschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das tat etwa Philipp Lotmar in seinem umfassenden Werk „Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des Deutschen Reiches“ von 1902. Dem in Bern lehrenden Juraprofessor ging es dabei vor allem um einen Punkt, die „Unabdingbarkeit“ von Tarifverträgen. Denn, so erläutert WSI-Forscher Schulten: „Nur wenn der Tarifvertrag in der Lage ist, die kollektive Regelung von Löhnen und Arbeitsbedingungen verbindlich sicherzustellen, können innerhalb eines bestimmten Geltungsbereiches die Lohnkonkurrenz aufgehoben und für alle Unternehmen gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden.“ Daher forderte Lotmar die Einführung eines Tarifvertragsgesetzes, das für die Verbindlichkeit von Tarifverträgen sorgt. Allerdings ging er weiterhin davon aus, dass es sich bei Tarifverträgen im Kern um eine privatrechtliche Angelegenheit handelt. Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften verstand er lediglich als Vertretungen ihrer Mitglieder.
In dem Punkt widersprach Sinzheimer. Bei einer rein privatrechtlichen Interpretation des Tarifvertrags könnten sich einzelne Arbeitgeber, die mit dem Verhandlungsergebnis nicht zufrieden sind, relativ einfach weigern, es zu akzeptieren. Man müsse einsehen, meinte Sinzheimer, dass „mit den Methoden eines individualistischen Rechtsdenkens der soziale Sinn des Tarifvertrags nicht zum Ausdruck kommen kann“.
Er vertrat die Auffassung, dass Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften als eigenständige Rechtssubjekte Tarifverträge in eigenem Namen und nicht nur als Vertretung ihrer Mitglieder abschließen. „Dies hat zur Folge, dass Tarifverträge gerade unabhängig von der Haltung Einzelner für alle Mitglieder der Tarifvertragsverbände Gültigkeit haben“, erklärt Schulten. Nur durch die „Herrschaft des Kollektivwillens über den Individualwillen“, formulierte Sinzheimer, lasse sich die Unabdingbarkeit von Tarifverträgen letztlich sicherstellen.
Tarifverträge sind Ausdruck von Wirtschaftsdemokratie
Eine ausschließlich privatrechtliche Sichtweise lehnte er ebenso ab wie eine rein staatsbezogene. Vielmehr stellten Tarifverträge eine Form der „sozialen Selbstbestimmung“ dar, die, so Schulten, „eine in sozialen Kämpfen entwickelte Antwort auf die strukturelle Machtasymmetrie von Arbeit und Kapital darstellt und deren Legitimation letztendlich in einer wirtschaftsdemokratischen Verfasstheit der Gesellschaft begründet liegt“. Die abhängig Beschäftigten sollten von „Wirtschaftsuntertanen zu Wirtschaftsbürgern“ werden. Das wirtschaftsdemokratische Recht auf Tarifverträge habe damit den gleichen Stellenwert wie das allgemeine Wahlrecht.
Tarifverträge werden von den Verbänden als private Akteure geschlossen und nicht vom Staat vorgegeben, sind aber im Sinne eines öffentlichen Rechts trotzdem für die ganze Branche gültig: Dieses Sinzheimersche Konzept bestimmte das Tarifrecht der Weimarer Republik und wurde bei der Gründung der Bundesrepublik weitgehend übernommen.
So hat das Prinzip der Unabdingbarkeit Eingang in das Tarifvertragsgesetz von 1949 gefunden. Ebenfalls aus der Weimarer Vorlage stammt das von Sinzheimer nachdrücklich befürwortete Instrument der Allgemeinverbindlicherklärung, mit dem sich Tarifverträge auch auf Unternehmen erstrecken lassen, die nicht Mitglied im Arbeitgeberverband sind.
Das Grundgesetz kennt kein „negatives Koalitionsrecht“
Das Grundgesetz sieht in Artikel 9 das Recht vor, „zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden“, das sogenannte positive Koalitionsrecht. Von einem „negativen Koalitionsrecht“ – einem Recht, sich von kollektiven Verhandlungen fernzuhalten und deren Ergebnisse zu ignorieren –, mit dem Arbeitgeber in jüngster Zeit häufig argumentieren, ist nirgends die Rede.
Insgesamt folgt das Grundgesetz mit seiner Forderung nach einer „im öffentlichen Interesse liegenden autonomen Ordnung des Arbeitslebens“ der Linie Sinzheimers, so WSI-Forscher Schulten. Wobei „die Tarifautonomie einen wesentlichen Bestandteil ausmacht“. Dies ist auch die Sicht des Bundesverfassungsgerichts. Entsprechend hat das höchste Gericht 2017 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gesetzliche Regelungen, die die Funktionsfähigkeit des Systems der Tarifautonomie sichern sollen, einen legitimen Zweck verfolgen.
Nichtsdestotrotz würden Tarifverträge heute von einigen Arbeitgebern und Juristen wieder als Akt „kollektiv ausgeübter Privatautonomie“ betrachtet, wie es vor Sinzheimers Zeiten der Fall war, warnt Schulten. Mit dem Ziel der „Delegitimierung von jeglichen staatlichen Maßnahmen und Instrumenten, die zum Beispiel in Form von Tariftreueklauseln bei öffentlichen Aufträgen oder der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen darauf abzielen, der sinkenden Tarifbindung in Deutschland entgegenzutreten“. Dabei sollte es „im Sinne Sinzheimers“ heute vielmehr darum gehen, „durch eine Stabilisierung der Tarifautonomie auch die Wirtschaftsdemokratie in Deutschland wieder zu stärken und damit nicht zuletzt auch der Krise der politischen Demokratie entschlossen entgegenzutreten“.
Thorsten Schulten: Tarifautonomie und Wirtschaftsdemokratie. Zur Aktualität von Hugo Sinzheimer anlässlich seines 150. Geburtstags, in: Florian Rödl, Felix Syrovatka (Hg.): Tarifbürgerschaft. Die Tarifautonomie in der modernen Demokratie, Campus 2025