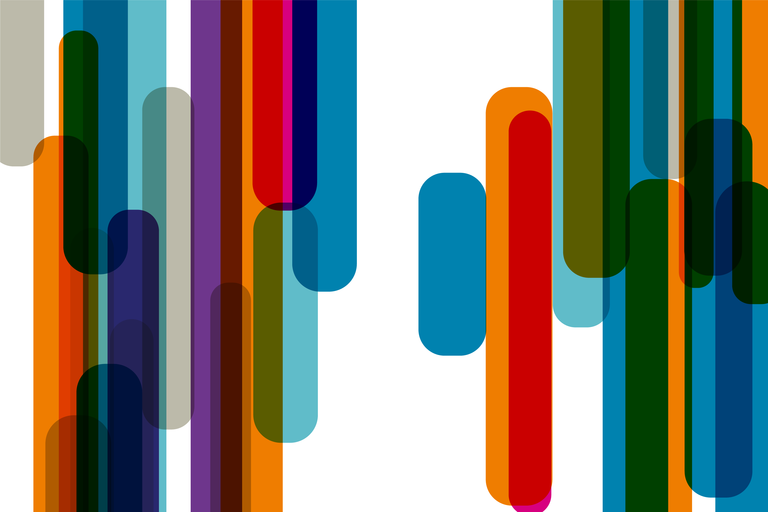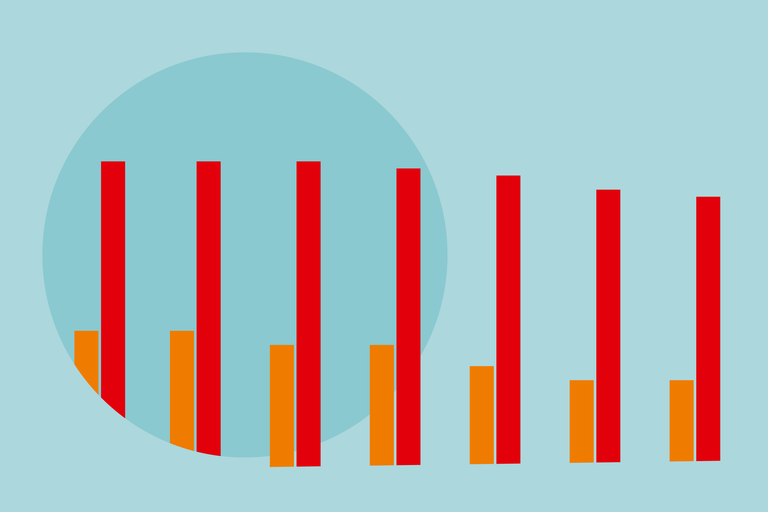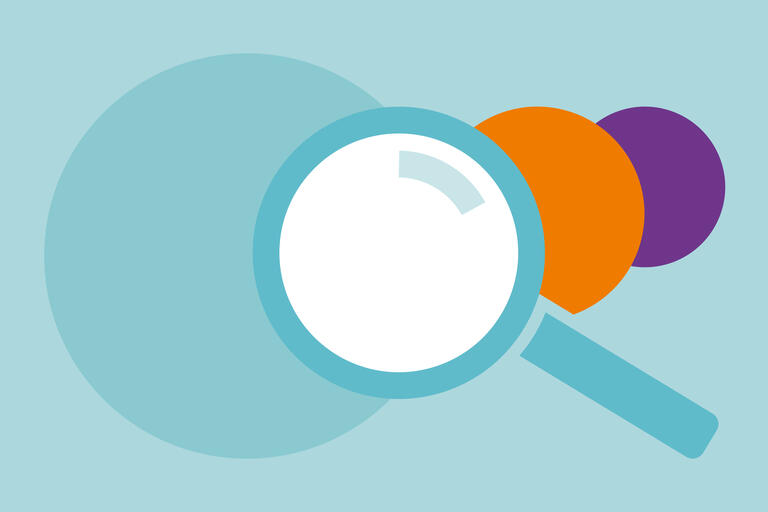Interview: „Eine neue Idee von Sozialpartnerschaft“
Wolfgang Schroeder, Politikwissenschaftler und Staatssekretär in Brandenburg, über die Krise des Flächentarifs, die Erosion der Arbeitgeberverbände – und seine Ideen, was dagegen getan werden kann. Das Gespräch führten Margarete Hasel und Joachim F. Tornau
Herr Schroeder, in Brandenburg ist ein sogenannter Sozialpartnerdialog ins Leben gerufen worden. Warum muss sich die Landesregierung einschalten, damit Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften miteinander reden?
In Ostdeutschland gibt es derzeit nur wenig Arbeitsplätze auf tarifvertraglicher Grundlage. Der Niedriglohnsektor ist außerordentlich groß und gute Arbeit rar. In den neuen Bundesländern verdient ein Drittel der Beschäftigten weniger als 8,50 Euro pro Stunde. Für die Zukunft droht wegen der demografischen Entwicklung zudem ein erheblicher Fachkräftemangel. Mit dem Sozialpartnerdialog wollen wir gute Arbeit fördern, aber auch die Sozialpartner stärken. Denn es fehlen die starken Akteure, die man bräuchte, um eine Selbstregulation von Wirtschaft und Arbeitsmarkt zu erreichen. Was in Brandenburg gut funktioniert, sind gelebte Betriebspartnerschaften, aber die Sozialpartnerschaft befindet sich noch sehr in den Anfängen.
Was meinen Sie damit?
Wir haben den Rahmen, aber keine hinreichend handlungsfähigen Strukturen. Die Gewerkschaften in Brandenburg kommen auf einen Organisationsgrad von etwa zehn Prozent. Und bei den Arbeitgeberverbänden sieht es nicht besser aus. In der Metallindustrie sind von insgesamt 1800 Unternehmen vielleicht 35 tarifgebunden. Unser erstes Ziel ist, die Mitgliedschaft in Verbänden als positives Gut in der öffentlichen Debatte zu platzieren. Wir wollen vermitteln, dass es nachhaltiger ist, auf Tarifverträge und auf qualitative Formen des Wettbewerbs zu setzen als allein auf den kurzfristigen Lohnwettbewerb. Gut ist, dass Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände in dieser Frage wirklich an einem Strang ziehen und beide ein hohes Interesse am Erfolg der Sozialpartnerschaft haben.
Die Politik spielt den Moderator?
Nicht nur. Wir stellen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften auch Mittel zur Verfügung, damit sie mit Projekten zu Fragen der Arbeitsorganisation, zu Gesundheitsmanagement oder Weiterbildung in die Betriebe gehen können – um auf diese Weise Mitglieder zu gewinnen. Arbeitgeber wie Beschäftigte sollen erleben, dass man über die Verbände und über die Gewerkschaften eine Perspektive bekommt, die man allein nicht hat. Das sind natürlich zaghafte Bemühungen, die eine funktionierende Selbstorganisation nicht ersetzen können. Wir versuchen, Hebamme zu spielen, damit die Tarifpartner wieder selbst zu den zentralen Akteuren werden können.
Allein auf die Sozialpartnerschaft wollen Sie aber offenbar nicht vertrauen: Seit Januar 2012 gilt in Brandenburg ein Vergabegesetz, das bei öffentlichen Aufträgen einen Mindestlohn vorschreibt.
Nach Rheinland-Pfalz haben wir als zweites Bundesland eine Mindestlohnkommission geschaffen. Sie ist – nach dem Vorbild der „Low Pay Commission“ in Großbritannien – paritätisch zusammengesetzt aus Ministeriumsvertretern, Arbeitgebern, Gewerkschaftern und Wissenschaftlern. Im Juni hat sie für Aufträge von Landesregierung und Kommunen einen Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde empfohlen. Außerdem sind Wirtschaftssubventionen in Brandenburg an die Bedingung geknüpft, dass neu entstehende Arbeitsplätze ein Jahresgehalt von mindestens 25.000 Euro bedeuten und eine bestimmte Leiharbeitsquote nicht überschritten wird. Das sind Versuche, den Niedriglohnsektor im Land einzudämmen.
Inwiefern haben Sie es mit einem spezifisch ostdeutschen Problem zu tun?
Das Besondere steckt nicht in einem einzelnen Punkt. Die ostdeutsche Ökonomie ist eine Dependenzökonomie, es gibt bei den größeren Betrieben fast nur Ableger von westdeutschen oder internationalen Konzernen. Die Betriebe sind wesentlich kleiner als im Westen – von den insgesamt rund 70 000 Unternehmen in Brandenburg haben gerade einmal rund 3000 mehr als 50 Beschäftigte. Auch Industrieanteil und Exportorientierung sind weitaus geringer. Das Bild ist immer noch geprägt von der Niedriglohnstrategie der ersten zwei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung. Hinzu kommt, dass die Kumulation dieser Faktoren eingekleidet ist in das schwierige Erbe 40-jähriger SED-Herrschaft.
Wie wirkt sich das aus?
Gewerkschafter und betriebliche Funktionäre genießen vielerorts keine hohe Wertschätzung. Dafür sind die Erwartungen an den Staat nach wie vor stärker ausgeprägt.
Als Erster-Mai-Redner haben Sie in diesem Jahr die Tarifautonomie als „Fundament unserer Gesellschaft“ bezeichnet. Was passiert denn, wenn dieses Fundament fehlt? Hat das Folgen über die Ökonomie hinaus?
Das hat auch Auswirkungen auf das Selbstverständnis einer Gesellschaft, auf die soziale Schichtung, auf Durchlässigkeit und Zusammenhalt. Tarifautonomie und Flächentarifvertrag sind Instrumente, um die Verteilung von Arbeit und Einkommen gesellschaftlich sowie volkswirtschaftlich zu öffnen und das einzelwirtschaftliche Kalkül etwas zu relativieren. Ihr Fehlen führt zu einem wesentlich höheren Maß an Ungleichheit. Für diejenigen, die von ihrer Herkunft wenig soziales und ökonomisches Kapital mitbringen, bedeutet das schlechtere Aufstiegsmöglichkeiten. Für eine Gesellschaft, die schrumpft, bedeutet es eine geringere Reproduktionsfähigkeit. Nicht zu vergessen sei zudem die Gefahr des Fachkräftemangels und damit sinkender Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.
Damit sind wir bei einer Analyse, die weit über den Osten Deutschlands hinausreicht. Auch in anderen Teilen des Landes wachsen die weißen Flecken in der Tariflandschaft. Ein Grund dafür sind die Erosionsprozesse im Arbeitgeberlager. Was verbirgt sich hinter dieser schwindenden Verpflichtungsfähigkeit den eigenen Leuten gegenüber?
Immer weniger Unternehmen erscheint es noch selbstverständlich, dass die Bindung an Kollektivnormen einen Nutzen darstellt. Die Mitgliederzahl der Arbeitgeberverbände ist seit den 1980er Jahren rückläufig, ihr Einfluss auf die Mitglieder nimmt stetig ab. Das haben die Verbände zum Teil auch selbst verschuldet, weil sie sich unzureichend angepasst haben an die veränderten Wettbewerbsbedingungen und an die veränderten Bedarfe der einzelnen Unternehmen. Statt beispielsweise zusätzliche Serviceleistungen für kleine und mittlere Betriebe aufzubauen, haben sie sich für einen Prozess der Desorganisation entschieden und die Verbandsmitgliedschaft ohne Tarifbindung, die sogenannte OT-Mitgliedschaft, eingeführt – um sich wenigstens ihre Finanzausstattung zu erhalten. Das ist übrigens auch die entscheidende Zäsur in der Entwicklung unserer Arbeitsbeziehungen.
OT-Mitgliedschaften funktionieren auch als tarifpolitisches Druckmittel.
Arbeitgeber können in Tarifverhandlungen damit drohen, dass sie in OT-Strukturen wechseln – dann verliert die Gewerkschaft ihren Verhandlungspartner, und die Sache ist beendet. Wir haben in den deutschen Arbeitsbeziehungen jetzt drei Welten: In der ersten ist die Sozialpartnerschaft noch selbstverständlich, weil sie als nützlicher Beitrag zur Regulierung des Wettbewerbs begriffen wird. Das betrifft vor allem die exportorientierte Chemie- und Metallindustrie. Bei der zweiten Welt könnte man von Gelegenheitssozialpartnerschaft sprechen: Wenn’s nutzt, ja. Sonst nein. Und dann gibt es eine immer größer werdende dritte Welt, wo die Sozialpartnerschaft grundsätzlich abgelehnt wird. Da herrscht der reine Arbeitsmarkt, der reine Kapitalismus. Insofern kann man nicht von „der“ Sozialpartnerschaft sprechen. Wir haben Zonen mit unterschiedlich regulierten Arbeitsbedingungen. Wirkliche Sozialpartnerschaft gibt es nur in einer Zone. Und die wird immer kleiner.
Wie wirkt sich diese Aufspaltung in „drei Welten“ auf die Arbeitgeberverbände selbst aus?
Verbände bringen Wettbewerber von sehr unterschiedlicher Größe und Qualität zusammen – von multinationalen Unternehmen bis zu mittelständischen Betrieben. Diese kleineren Betriebe steigen nun zunehmend aus, sogar in den Branchen der sogenannten ersten Welt: Bei Gesamtmetall sind von den 6800 Mitgliedern mittlerweile fast 3200 im OT-Bereich. Wenn aber bald nur noch die großen, starken Unternehmen tarifgebunden sind, stellt sich die Frage: Hat der Verband für sie dann überhaupt noch eine Funktion? Noch profitieren sie ja davon, dass auch die Kleinen Mitglieder sind, weil dann nicht ihre Leistungsfähigkeit allein das Maß der Dinge ist, sondern eine Durchschnittsproduktivität. Was für sie natürlich günstiger ist.
Die Sozialpartnerschaft ist in der Krise. Gleichzeitig hat sie sich zuletzt jedoch als sehr belastbares Instrument zur Bewältigung der Finanzkrise erwiesen. Wie erklärt sich dieses Paradoxon?
Diese Krisenkooperationspolitik fiel nicht vom Himmel, sondern ist in den betreffenden Branchen der Metall- und Chemieindustrie schon vorher vorhanden. Tarifautonomie und Sozialpartnerschaft sind nicht einfach technische Veranstaltungen. Es hat sich gezeigt, dass man korporatistische Akteure braucht, die auf Vertrauen und Verhandlungserfahrung aufbauen und so gemeinsam handeln können. Das hat in dieser Situation beispielhaft funktioniert – und könnte nun als Episode einfließen in die große Erzählung, die davon handelt, wie es einmal mehr gelungen ist, unsere Gesellschaft vor sich selbst zu schützen. Und vor dem Markt.
Manche Forscher sprechen deshalb von einer „Renaissance“ oder „Revitalisierung“ der Sozialpartnerschaft.
Da wäre ich vorsichtig optimistisch. Der Niedriglohnsektor ist stabil, bei der Primärverteilung gibt es keine Bewegung. Die Mitgliederzahlen der Gewerkschaften wachsen zwar etwas, aber auch das würde ich nicht überbewerten. Und bei den Arbeitgeberverbänden haben wir nach wie vor eine permanente Erosion. Damit nimmt die Regulationsfähigkeit der Verbände immer weiter ab – und die Bedeutung des Staates immer weiter zu. Doch es gibt derzeit keine offensive Politik, die es vermocht hat, die Sozialpartnerschaft nach vorne zu bringen.
Dafür gibt es mittlerweile einen weiten Konsens über die Notwendigkeit eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns. Inwieweit könnte das helfen?
Ein Mindestlohn würde Druck wegnehmen vom tarifpolitischen Geschehen. Der freie Fall nach unten wäre abgebremst. Ob das für die Arbeitgeber in bestimmten Branchen eine Motivation wäre, sich verbandlich zu organisieren, das wissen wir noch nicht.
An der Spitze der wichtigen Arbeitgeberverbände findet gerade ein Generationswechsel statt. Wird das politisch-ideologisch frischen Wind bringen?
Das ist offen. Für die Aufbaugeneration der Väter, die die Entwicklung bis in die 1980er Jahre geprägt hat, war die Sozialpartnerschaft die ideenpolitische Antwort auf den Klassenkampf und die Systemkonkurrenz angesichts der Spaltung Deutschlands und damit ein nützliches Gut. Auch konnten sie damit die Hypothek ihrer NS-Mittäterschaft relativieren. Danach folgten die Henkels und Rogowskis, die sich davon entschieden absetzten und einen umfassenden Bruch mit dem deutschen Modell versuchten. Die jetzt kommen, sind keine Ideologen, sondern eher Pragmatiker. Ob sie eine eigene Vision von Sozialpartnerschaft haben, ist bislang nicht erkennbar. Dabei wäre das dringend nötig: Es gilt, das deutsche Modell kompatibel zu machen mit den Herausforderungen der Demografie und der Globalisierung. Mit Pragmatik allein ist das nicht zu schaffen.
In Ihren wissenschaftlichen Arbeiten nennen Sie das 21. Jahrhundert das „Jahrhundert der Mitglieder“ – das das „Jahrhundert der Verbände“ abgelöst habe. Das heißt, individuelle Interessen stehen im Mittelpunkt. Wie können die Arbeitgeber vor diesem Hintergrund zu einer positiven Vision von Sozialpartnerschaft kommen?
Die Verbände müssen beweisen, dass der individuelle Nutzen, in einem Kollektiv organisiert, zu einem Mehrwert führt. Dafür müssen sie wacher, durchlässiger und beweglicher werden. Sie müssen aber auch erklären können, warum sich Unternehmen nicht direkt dem Markt oder dem Staat unterwerfen sollen. Und warum selbstgenügsame Betriebspartnerschaften, wie sie in Ostdeutschland bereits vorherrschendes Leitbild sind, für die Entwicklung einer dynamischeren Gesellschaft nicht ausreichen. Es braucht eine neue Idee von Sozialpartnerschaft als Modell, das sozialen Zusammenhalt, Dynamik, Wettbewerbsfähigkeit zum Inhalt hat – und damit neue Win-win-Situationen.
Taugen die bestehenden Institutionen zu einem solchen Neubeginn?
Künftig wird es mehr Pluralität geben, aber auch schnellere Wechsel und Veränderungen. Verbände und Gewerkschaften, die naturgemäß eher langsam sind, werden das alleine nicht steuern können. Deshalb sollte man als Ergänzung über Netzwerke nachdenken, die schnell und lösungsorientiert auf aktuelle Probleme reagieren – und die auch kleinere Einheiten umfassen können. Weil aber auch das noch unzureichend sein dürfte, um flächendeckende Angebote machen zu können, könnte ich mir flankierend eine Arbeitskammer mit Pflichtmitgliedschaft für alle Arbeitnehmer vorstellen.
Würde das keine Konkurrenz für die Gewerkschaften bedeuten?
In Ostdeutschland haben rund 70 Prozent der Arbeitnehmer keinen Ansprechpartner für ihre Belange, weder einen Betriebsrat noch einen Gewerkschaftsvertreter. Das kann nicht sein. Mit einer Arbeitskammer würden sie eine erste Anlaufstelle für Fragen des täglichen Arbeitslebens erhalten, ähnlich wie es das mit den Arbeitnehmerkammern in Bremen und im Saarland schon gibt. Außerdem kämen sie damit auf Augenhöhe mit der Arbeitgeberseite, die solche Institutionen in Form der Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern ja bereits hat. Natürlich darf das nicht dazu führen, die Gewerkschaften zu schwächen und ihre Kernkompetenzen anzugreifen. Vielmehr muss das Gegenteil der Fall sein. Dann wäre dies eine Chance für die Gewerkschaften. Das muss natürlich genau austariert werden. Aber ich finde, es wäre eine Debatte wert.
Zur Person
Wolfgang Schroeder, 53, hat den Lehrstuhl „Politisches System der BRD – Staatlichkeit im Wandel“ an der Universität Kassel inne. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem Verbände und Gewerkschaften. Seit 2009 ist er von seiner Professur beurlaubt und arbeitet als Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familien des Landes Brandenburg. Schroeder gehört der Grundwertekommission der SPD an und war jahrelang für die IG Metall tätig.