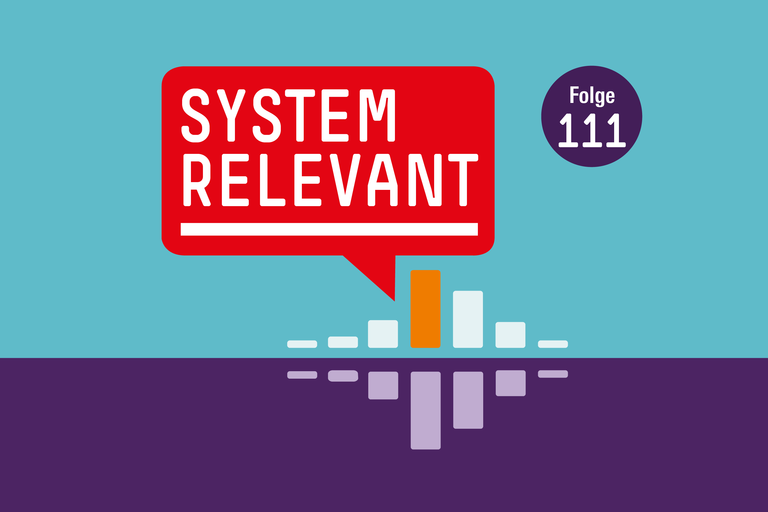Interview: "Ein Traumjob"
Sebastian Dullien, der neue wissenschaftliche Direktor des IMK, erklärt seine Überzeugungen als Forscher, seine Pläne für das IMK und seine Ratschläge an die Politik. Das Gespräch führte Kay Meiners.
Sie sind seit April Nachfolger von Gustav Horn. Wie würden Sie Ihre wissenschaftliche Ausrichtung beschreiben?
Ich würde sagen, dass ich ein pragmatisch und empirisch orientierter Ökonom bin, der sich die Fakten ansieht und dann schaut, was in der aktuellen Situation das beste Modell ist, um die Fakten zu analysieren und zu erklären.
Welche Grundüberzeugungen haben Sie, die Sie nicht mit allen Kollegen Ihrer Profession teilen?
In meiner Profession gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die extrem marktgläubig sind. Ich bin da skeptischer. Das Lehrbuchmodell der perfekten Märkte, was an der Uni im ersten Semester benutzt wird, taugt meist nicht für die Realität. Märkte sind viel komplexer: Die eine Marktseite hat mehr Macht als die andere, sie weiß mehr, oder es gibt hohe Transaktionskosten. Wenn man es so betrachtet, macht es in mehr Fällen Sinn, dass der Staat in den Markt eingreift, als es die Mehrzahl der deutschen Ökonomen glaubt.
Eingreifen heißt auch, Geld in die Hand nehmen?
Klar. Es gibt Situationen, wo der Staat Geld in die Hand nehmen und als Marktakteur aktiv werden muss: Etwa beim Personenverkehr, beim öffentlichen Wohnungsbau, bei der Förderung von Forschung und Entwicklung – da gibt es wirklich ganz viele Situationen.
Mussten Sie – bei dieser Ausrichtung – noch überlegen, als das Jobangebot vom IMK kam?
Ich kenne das IMK und die Hans-Böckler-Stiftung ja schon sehr lange. Das Institut macht eine tolle Arbeit. Daher war es für mich schon ein Traumjob, hierherzukommen.
Sie sind seit 2007 Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und bleiben es auch neben Ihrer Tätigkeit am IMK zumindest in Teilzeit. Davor allerdings haben Sie als Journalist gearbeitet.
Genau. Ich war acht Jahre bei der Financial Times Deutschland – aber nicht immer in Vollzeit. Zeitweise habe ich zwei Drittel gearbeitet, um meine Promotion abzuschließen.
Sie haben zur Eurozone promoviert, die damals gerade eingerichtet war. Die Gemeinschaftswährung war erst ein Jahr alt.
Das Hauptthema meiner Dissertation war das Zusammenspiel von Geld- und Lohnpolitik in der Eurozone. Es ging darum, wie verschiedene Lohnverhandlungssysteme innerhalb der Eurozone miteinander kompatibel sein können und was sich daraus für ein Gesamtlohnverhandlungssystem für die Eurozone ergeben würde.
Wie ist das zu verstehen? Im Sinne einer zukünftigen europäischen Tarifpolitik?
Ja. Eine wirkliche europäische Tarifpolitik gibt es ja noch nicht. Wir haben weder europäische Tarifverträge noch haben wir eine implizite Koordinierung wie in den Nationalstaaten – also derart, dass eine Gewerkschaft in einem Bezirk die erste Verhandlung führt und die anderen dann quasi nachziehen. Also habe ich untersucht, wie es heute in Europa funktioniert.
Und der Bezug zur Makroökonomik?
Wenn man bei den Lohnverhandlungen eine hohe Koordination hat, etwa einen Flächentarif oder andere sehr koordinierte Verfahren, kann ein Land bessere makroökonomische Ergebnisse haben, also eine höhere Beschäftigung und eine niedrigere Inflation, weil die Tarifparteien die gesamtwirtschaftlichen Anforderungen in ihre Lohnverhandlungen miteinbeziehen. Das funktioniert auf europäischer Ebene noch nicht, könnte aber sinnvoll sein.
Was hat Sie eigentlich gereizt, sich schließlich gegen den Journalismus und für die Wissenschaft zu entscheiden?
Die Wissenschaft hat mich schon sehr lange interessiert. Ich hatte zum Ende meines Studiums ein Praktikum im DIW gemacht, wo damals auch Gustav Horn arbeitete. Hier habe ich ihn kennengelernt. Die Arbeit dort hat mich schon sehr gereizt. Ich bin dann aber erst einmal zur Financial Times Deutschland gekommen. Die haben sehr dringend Leute gesucht und gut bezahlt. Das habe ich ein paar Jahre gemacht.
Und dann ließ die Faszination nach?
Ich hatte den Eindruck, dass ich mich im Tagesjournalismus nicht mehr so tief mit den Sachen beschäftigen konnte, wie ich das gerne wollte. Gleichzeitig waren die Aufstiegschancen wenig attraktiv. Wenn man im Journalismus aufsteigen möchte, geht man von den Fachinhalten zu Koordinierungsfunktionen, wo man dann anderen Leuten sagen muss, wann sie ihre Texte zu liefern haben und Texte anderer Leute daraufhin überprüfen muss, ob Überschriften und Namen richtig geschrieben sind. Das war – kombiniert mit ungünstigeren Arbeitszeiten – nicht das, was ich gerne machen wollte. Darum habe ich mich dann woanders beworben und bin 2007 an die HTW Berlin berufen worden.
Wie wollen Sie Ihre journalistische und wissenschaftliche Doppelqualifikation am IMK einbringen?
Ich glaube, dass man das, was wir tun, manchmal noch besser verkaufen und mehr Leuten näherbringen könnte. Und dass wir das IMK attraktiver für Gewerkschafter und Politiker machen können. Wir haben schon ein paar Ideen.
Welche Ideen sind das?
Wir wollen mehr Diskussionsveranstaltungen machen. Mit Referenten aus Ministerien, vielleicht mit Verbandsvertretern und den Gewerkschaften. Die haben ja alle auch Volkswirte und Referenten, Grundsatzreferenten. Und mit Journalisten. Um da über aktuelle Fragen in den Dialog zu kommen. Darüber hinaus werden wir versuchen, die Social-Media-Präsenz zu steigern. Hier wollen wir mit neuen Formaten experimentieren.
Welche Art von Dialog ist fruchtbarer: Der mit Gleichgesinnten oder der mit Leuten, die ganz anders denken?
Ich glaube, in der Wissenschaft braucht es beides. Man braucht die Auseinandersetzung mit denen, die anders denken, weil man da am besten die Schwächen der eigenen Argumentation erkennen kann. Wenn man aber sein Theoriegebäude weiterentwickeln will, braucht es den Dialog mit Leuten, die auf ähnlichen Prämissen aufbauen.
Ihr Vorgänger Gustav Horn sprach vorsichtig von einer leichten Renaissance keynesianischer Ideen. Ist das die Realität?
Ich würde sagen, dass der aufgeklärte ökonomische Mainstream international heute ein signifikantes Element keynesianischen Denkens enthält. Das sieht man daran, dass Konjunkturpakete ganz anders bewertet werden als früher und dass die Rolle des Staates wieder zunehmend positiv gesehen wird.
Welche Rolle fällt dem IMK in der Debatte zu?
Es gibt viele makroökonomische Fragen, die die anderen deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute bestenfalls einseitig abdecken. Fangen wir an mit der Frage der Finanzpolitik und der Schuldenbremse. Hier hat das IMK mit seiner Kritik lange alleine gestanden und damit eine Vorreiterrolle gehabt. Jetzt ziehen andere nach. Das IMK hat auch früh makroökonomische Aspekte von Verteilungsfragen thematisiert oder die Rolle der Lohnentwicklung für einen stabilen Aufschwung. In all diesen Fällen war die internationale Debatte schon weiter als die deutsche Debatte, und das IMK hat dazu beigetragen, diese modernen und progressiven Positionen im deutschen Diskurs voranzubringen. Hier sehe ich eine wichtige Aufgabe des IMK.
Gehen wir die Punkte kurz durch. Die Schuldenbremse haben Sie scharf kritisiert, weil sie Investitionen behindert. Sie sagen aber auch, dass es Spielräume gibt.
Ja, die deutschen Regeln sind bei der Frage, was dem Staatssektor zugerechnet wird, wesentlich lockerer als die europäischen. Das bedeutet, dass man im Rahmen der Schuldenbremse durchaus öffentliche Unternehmen gründen könnte, die Kredite aufnehmen und damit Infrastruktur bereitstellen, wenn dann hinterher ein Zahlungsstrom an diese öffentlichen Unternehmen zurückfließt.
Gibt es so etwas schon?
In Berlin ist der Schulbau teilweise heute schon so organisiert, dass eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, die HOWOGE, für eine gewisse Zeit Grundstücke von den Bezirken übertragen bekommt, Kredite aufnimmt, Schulen darauf baut und die Schulen an die Bezirke zurückvermietet. Das ist eine öffentlich-öffentliche Partnerschaft, weil die HOWOGE zu 100 Prozent in öffentlichem Eigentum ist. Der Clou ist, dass die Schulden der HOWOGE nicht unter die Schuldenbremse fallen, weil das Unternehmen am Markt tätig ist.
Eine Konstruktion, mit der man die Schuldenbremse umgehen kann?
Eine Konstruktion, die diejenigen Spielräume ausschöpft, die der Gesetzgeber lässt. Mit solchen Konstruktionen könnte man auch den Wohnungsmarkt entspannen, aus dem sich der Staat massiv zurückgezogen hat. Warum nicht in Ballungsgebieten mit Wohnraummangel neue, kommunale Gesellschaften gründen, ohne damit die Schuldenbremse zu verletzen? Im Extremfall ist sogar eine Bundeswohnungsbaugesellschaft denkbar, die Kredite aufnimmt und Wohnungen baut.
Kommen wir zu Europa. Was läuft da schief?
Wir haben in der Währungsunion eine ganze Reihe von Problemen. Wir hatten Phasen, wo es bestimmten Ländern sehr gut ging, wo dann sehr viel Geld ausgegeben wurde, wo auch der Bausektor in den Ländern geboomt hat. Danach kam es oft zum Absturz, weil es eine Blasenbildung gab. Dann sind die Länder in die Krise gerutscht. Das sind Dinge, die man angehen müsste. Da gibt es verschiedene Instrumente – etwa eine europäische Arbeitslosenversicherung. Sie würde im Boom etwas Kaufkraft abziehen und in der Krise die Kaufkraft stabilisieren. Heute gäbe es in Deutschland wahrscheinlich keine politische Mehrheit dafür. Aber bei manchen Ideen geht es darum, sie zu erklären und dann um Mehrheiten zu kämpfen.
Das IMK trägt nicht nur die Makroökonomie im Namen, sondern auch die Konjunkturforschung und -prognose. Wird es weiter eine eigene Prognose geben?
Ja. Konjunktur wird immer dann interessant, auch für die Öffentlichkeit, wenn es mal nicht so rundläuft. Die vergangenen Jahre ist es sehr rundgelaufen. Darum hat das Interesse an Konjunkturprognosen in der Öffentlichkeit ein bisschen abgenommen. Für uns bleibt sie aber wichtig, weil sie die Wissenschaftler dazu zwingt, sich im Detail mit realwirtschaftlichen Daten zu beschäftigen. Das ist sehr wichtig als Plausibilitätscheck unserer Modelle, aber auch, um Wirkungskanäle in der Wirtschaft zu erkennen und zu verstehen.
Und die Konjunkturpolitik? Es gibt aktuell ja große Risiken, auch wenn wir noch nicht im Krisenmodus sind.
Der Staat muss Pläne machen, die er schnell umsetzen kann, wenn was passiert. Das können Investitionen sein, aber auch Pläne für eine ausgeweitete Kurzarbeit, wenn der Abschwung kommt. Oder Qualifizierungsprogramme für Kita-Erzieher oder Pfleger. Das sind alles Dinge, über die man sich jetzt Gedanken machen muss. Man kann sie dann in der Schublade liegen lassen. So verliert man keine kritischen Monate, wenn man sie braucht.
Das IMK wird sich über die Konjunkturpolitik hinaus auch den ganz großen Fragen stellen wie Nachhaltigkeit oder Globalisierung?
Unbedingt. Ich glaube, das sind Themen, die nicht nur für das IMK eine große Rolle spielen werden, sondern auch für die Hans-Böckler-Stiftung insgesamt. Wenn man sich die Diskussionen anguckt, die jetzt im Vorstand der Stiftung geführt worden sind, über die Herausforderungen der Globalisierung, ist explizit gesagt worden, dass die Frage der gerechten Umgestaltung der Gesellschaft ein Thema der Hans-Böckler-Stiftung sein soll. Das wird auch im IMK sein Echo haben. Wir können die ökologischen Probleme und die Klimafrage nicht ignorieren. Man muss sie aber in einer Art und Weise lösen, dass das nicht auf Kosten einzelner Gruppen, etwa der Arbeitnehmer, passiert.
Wie wollen Sie damit umgehen, dass das IMK einerseits der Ergebnisoffenheit der Wissenschaft verpflichtet, andererseits in politische Strukturen eingebunden ist?
Mein Verständnis ist, dass der Vorstand mit seinem Arbeitsplan die Themenfelder vorgibt, zu denen wir forschen. Wir machen das nach besten wissenschaftlichen Standards und präsentieren die Ergebnisse. Wenn wir zu Ergebnissen kommen, die in den Gewerkschaften so bisher nicht diskutiert wurden, müssen wir das kommunizieren und darüber reden. Dann versteht man, wo die Differenzen herkommen. Das ist für die Gewerkschaften eine wertvolle Dienstleistung. Wir sind dafür da, Handlungs- und Orientierungswissen zu produzieren. Das heißt, es geht zuerst darum, Erkenntnisse zu produzieren, wie die Welt funktioniert.